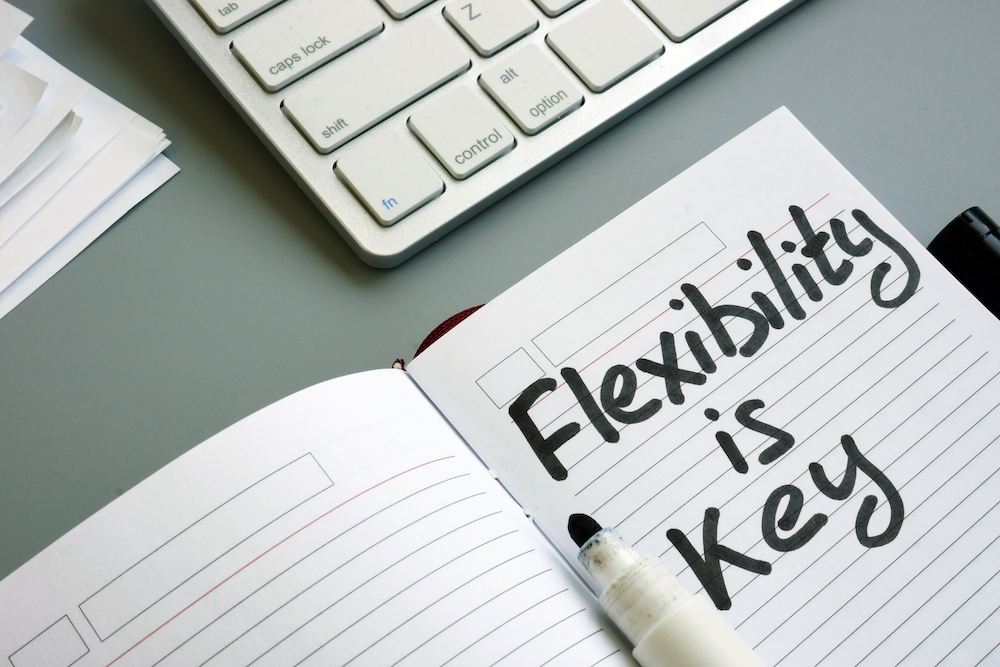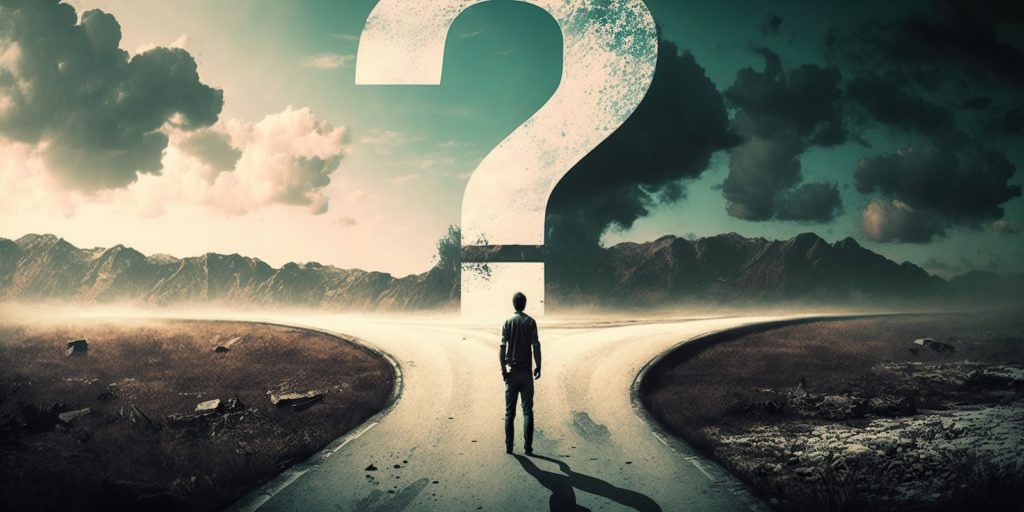Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund und Motivation einer C/sells-Arbeitsgruppe zum regulatorischen Rahmen
- Standardisierung beschleunigt Innovation und schafft Massenfähigkeit
- Glossar mit Begriffssystem zum zellulären Energiesystem als Grundlage von Beteiligung und Autonomie
- Zelluläre Architektur und Digitalisierung
- Use Case Methodik
- Schutzmethodik — Schutzbedürfnisse im Energiesystem
- Flexibilität — Begriff — Konzepte — Modell
- Zusammenfassung der Ergebnisse des Projektes C/sells zu gemeinsamen technischen Regeln, Normen und Standards
Flexibilität als Eigenschaft eines zellulären Energiesystems
Begriffe
Vorrangige Ziele der im Glossar „Begriffe und Modelle zum zellularen Ansatz sowie zu Infrastrukturkomponenten“ eingeführten Architektur sind
- Beherrschung von Komplexität in einem zunehmend dezentralen Energiesystem
- Erhöhung der Flexibilität im volatilen erneuerbaren Energiesystem im Sektorenverbund der Endenergiearten Strom, Wärme, Gas und Energieträger für Mobilität sowie zur Eigenoptimierung
- Erweiterung der Handlungsräume für lokale und regionale Partizipation und Eigengestaltung im globalen Verbund
- Erhöhung der Resilienz gegen Angriffe und Störungen der vernetzten kritischen Infrastruktur
Flexibilität ist also letztendlich bezogen auf den eingeführten Systembegriff eine sich zunehmend entwickelnde Eigenschaft des intelligenten, erneuerbaren Energiesystems.
Steuerungskategorien zur Nutzung von Flexibilität
Zwecks Kategorisierung von Mechanismen zur Steuerung eines Systems und insbesondere deren Anwendung für Flexibilitätsmechanismen im Energiesystem werden folgende fünf Unterscheidungsmerkmale definiert:
- Signalweg
- Steuerungsbereitschaft
- Steuerungsanforderung
- Steuerungsauslösung
- Steuerungsverantwortung
Signalweg
Zwecks Kategorisierung von Mechanismen zur Steuerung eines Systems — insbesondere zur Nutzung von Flexibilität — wird im ersten Schritt Bezug auf das Energiesystem genommen, wo die wesentlichen Attribute Energie und Information gleichzeitig Mittel der Beobachtung von Steuerungsnotwendigkeiten sowie der Ausführung eines Steuerungsprozesses sind. Zur Fallunterscheidung dient hierbei der Signalweg als erste Steuerungskategorie (1. Dimension des Steuerungsraumes) in nachfolgender Weise.
Die Beobachtung energiebezogener Attribute kann unmittelbar auf physikalischem Wege zur Steuerung eines anderen energiebezogenen Attributes genutzt werden, dessen Beeinflussung auf dem Wege der Rückkopplung zur Anpassung des beobachteten Attributes führt. Ein Attribut in Form einer messbaren physikalischen Größe bildet ein Signal, dessen Informationsgehalt unmittelbar auf eine andere physikalische Größe wirkt, deren Veränderung wiederum durch Rückkopplung die Ausgangsgröße anpasst. Hierzu wird der Begriff der zustandsbasierten Steuerung genutzt.
Im anderen Falle erfolgt die Umwandlung des durch Beobachtung eines Attributes erzeugten Signals in eine Nachricht sowie der Versand der in der Nachricht enthaltenen Information zum beobachteten Attribut über einen Kommunikationskanal. Der Empfänger verarbeitet diese Information zu einer Steuerentscheidung und überträgt wiederum über einen Kommunikationskanal die Steuerinformation als Nachricht an die ausführende Komponente des Systems, in dem ein Attribut im Rahmen der kommunikationsbasierten Steuerung angepasst werden soll, dessen Änderung ebenso das beobachtete Attribut beeinflusst.
Mit der im Glossar-Kapitel zum Systemmodell geführten Betrachtung wurde das Energiesystem als attributives System beschrieben, dessen jedes Element sich mit jedem anderen Element derselben Klasse in (wenigstens) einer Zusammenhangsrelation befindet, derart, dass die Gesamtheit der Klassenelemente ein „einheitlich geordnetes Ganzes“ bleibt. Dies umfasst die prinzipielle Erreichbarkeit jedes Attributes von jedem anderen Attribut ohne Umweg über ein zusätzliches Attribut (z.B. y in Abhängigkeit von x, d.h y(x), aber nicht y in Abhängigkeit von t in der Form y(x(t))) [Stachowiak, H. (1973)].
Steuerungsbereitschaft
Deshalb wird als zweite Steuerungskategorie (2. Dimension des Steuerungsraumes) als Steuerungsbereitschaft mit den zwei Ausprägungen explizite oder implizite Steuerung aus Sicht des Anbieters einer Steuerungsmöglichkeit definiert.
Die explizite Steuerung bedeutet, dass der Anbieter eines steuerbaren Systems zulässt, dass beispielsweise die Leistung P einer Anlage nach einer fest vereinbarten Steuergröße S (z.B. Leistungsdifferenz zu bestimmten Zeitpunkten), die unabhängig von einer weiteren Variable ist, gesteuert werden kann (Flexibilität). Aufgrund dieser Unabhängigkeit der Steuergröße S von anderen Variablen ist die zukünftige Leistung zu bestimmten Zeitpunkten bekannt und damit fest kalkulierbar, d.h. L = f(S).
Dagegen beschreibt die implizite Steuerung die Bereitschaft des Anbieters eines steuerbaren Systems, eine Steuergröße S zur Anpassung der Leistung P als abhängige Größe zu erhalten, die wiederum von einer abhängigen Variable, z.B. dem Preis PR beeinflusst wird. Beispielsweise beeinflusst ein variabler Preis die Steuergröße und passt damit auch die Leistung an. Nur ist die Beeinflussung der Steuergröße S durch den Preis nicht fest kalkulierbar, sondern nur prognostizierbar. Der Anbieter ermöglicht damit Prognosen auf sein zukünftiges Verhalten, aber keine definierte Leistung, d.h. L = f(S(PR))
Steuerungsanforderung
Dem Nachfrager der Steuerungsmöglichkeit eines Systems stehen nun in analoger Weise zwei Möglichkeiten einer dritten Steuerungskategorie (3. Dimension des Steuerungsraumes) als Steuerungsanforderung zur Verfügung. Einerseits kann er mittels eines Attributes, von dem das zu steuernde Attribut direkt abhängig ist, die Möglichkeit zur Steuerung vereinbaren. Hierzu wird der Begriff der direkten Steuerung definiert. Im Gegensatz dazu umfasst der Begriff der indirekten Steuerung den Einsatz eines steuernden Attributes, das nur auf dem Vermittlungsweg über ein anderes Attribut zur Veränderung beim zu steuernden Attribut führt.
Steuerungsauslösung
Zur Unterscheidung der Varianten bei Erbringung der gewünschten Steuerung wird die vierte Steuerungskategorie (4. Dimension des Steuerungsraumes) zur Steuerungsauslösung , z.B. zum Abruf einer angebotenen Flexibilität, definiert.
Die Steuerung von Komponenten innerhalb eines Systems kann sowohl auf Basis interner Systembeobachtung und Analysen als auch durch externe Beeinflussung über die Informations- und Energieschnittstellen erfolgen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Verbindung der Energiezelle horizontal zu einer Energiezelle gleicher Stufe oder vertikal zu einer Energiezelle einer anderen Stufe (einbettende oder untergeordnete Zelle) erfolgt. Insofern kann der Nachfrager der Steuerungsmöglichkeit den eigentlichen Steuerungsvorgang extern aus Sicht des Systems auslösen (externe Steuerung) oder einen selbsttätigen Auslösungsvorgang innerhalb des Systems (interne Steuerung) nutzen.
Steuerungsverantwortung
Weiterhin ist es notwendig, im Falle der Auslösung der Steuerung eines Systemattributes zwei weitere Fälle im Rahmen der fünften Steuerungskategorie (5. Dimension des Steuerungsraumes) zur Steuerungsverantwortung folgendermaßen zu unterscheiden.
Die Steuerung bezogen auf das System kann einerseits dadurch erfolgen, dass das zu steuernde Attribut an der Schnittstelle des Systems über eine Managementkomponente des Systems gesteuert wird, ohne direkt auf andere im System enthaltenen Komponenten oder Untersysteme einzuwirken. Das System handelt hier im Rahmen einer aktiven Steuerung auf Basis eigener Analysen und entscheidet, welche internen Attribute der Systemkomponenten dabei gesteuert werden sollen.
Erfolgt die Steuerung aber nicht an der Systemschnittstelle, sondern wirkt unmittelbar an ausgewählten Attributen dedizierter Komponenten, findet eine passive Steuerung statt.
Auf Basis dieser fünf Dimensionen des Steuerungsraumes und den 2 hoch 5 Ausprägungen ergeben sich 32 mögliche Kombinationen zur Nutzung von Flexibilität.
Steuerungskategorien anhand ausgewählter Flexibilitätsmechanismen
Das beschriebene Modell zur Kategorisierung von Steuerungsmechanismen wird nachfolgend am Beispiel ausgewählter Mechanismen der Bereitstellung von Flexibilität veranschaulicht.
Signalweg
Mit der ersten Steuerungskategorie werden die Signalwege eingeordnet.
Die zustandsbasierte Steuerung kann auf unterschiedlichsten Zustandsgrößen beruhen. Dies betrifft Netzzustandsgrößen wie Frequenz, Spannung und Phasenverschiebung, aber auch andere die Energieflüsse beeinflussende Größen wie die Temperatur.
Bekannt ist diese Steuerungsart beispielsweise im Rahmen der Primärregelung zur Steuerung der Netzfrequenz. Auf Basis der Beobachtung der Netzfrequenz und physikalischer Rückkopplung ändert sich automatisch die Drehgeschwindigkeit von Generatoren in Kraftwerken. Mit dem Fortschritt beim Ausbau der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen und dem damit verbundenen Wegfall von Kraftwerksgeneratoren werden zunehmend Lösungen geschaffen, die die Frequenzregelung mittels dezentraler Elektroniklösungen ermöglichen.
Analoge Einrichtungen der Leistungselektronik existieren zur Anpassung der Leistung von Stromverbrauchern, wenn die Netzspannung die Soll-Grenzen verlässt.
Auf der anderen Seite kann die kommunikationsbasierte Steuerung dadurch erfolgen, dass die Netzspannung an verschiedenen Netzanschlusspunkten einer Netzzelle gemessen und an die in diesem Netzgebiet zuständige Netzleitwarte oder eine intelligente Trafostation als Nachricht über einen sicheren Kommunikationskanal übertragen wird. Algorithmen der Systeme in der Leitwarte treffen basierend auf erhaltenen Informationen sowie mittels zusätzlichen Wissens um vergangene Situationen und Prognosen zur Zukunft Entscheidungen, um dann entsprechende Steuerinformationen an Teilsysteme oder Einzelanlagen im Netzgebiet zu senden.
Im letzten Beispiel kann die kommunikationsbasierte gegenüber der zustandsbasierten Steuerung vorteilhaft sein, weil es gilt, die Spannungen an verschiedenen Netzanschlusspunkten im Zusammenhang zu betrachten, um das optimale Steuerungsregime abzuleiten.
Steuerungsbereitschaft
Die zweite Steuerungskategorie dient der Einordnung der Steuerungsbereitschaft eines Anbieters, die hier im speziellen Falle auf die Bereitschaft zur Bereitstellung von Flexibilität bezogen wird.
Denkbar ist der proaktive Versand einer Nachricht durch einen Anschlussnutzer im Einfamilienhaus an seinen Energielieferanten, die Geräte im Wohnbereich durch variable Tarife in Verbindung mit einer durch den Dienstleister bereitgestellten Energiemanagementeinrichtung implizit steuern zu lassen. Die Änderung der Energienutzung durch derartig gesteuerte Komponenten beruht auf einem Anreizsystem. Verbrauchsänderungen sind also nur zu prognostizieren und nicht unmittelbar zu erreichen.
Die Bereitschaft als Anschlussnutzer, die Energienutzung bezogen auf das Einfamilienhaus oder nur in Bezug auf Einzelanlagen (z.B. Wärmepumpe, Ladepunkt Elektromobilität) durch zugeordnete und vorgegebene Fahrpläne (fixe Leistungsvereinbarungen zu bestimmten Zeitperioden) zu vereinbaren, wird bei expliziten Steuerungen genutzt, wobei die Vorlaufzeit zwischen Flexibilitätsvereinbarung und ‑erbringung stark variieren kann.
Steuerungsanforderung
In analoger Weise können die Mechanismen des Nutzers von Steuerungsmöglichkeiten bei der Steuerungsanforderung nachfolgend in spezieller Weise für die Anforderung von Flexibilität eingeordnet werden.
Die direkte Steuerung basiert analog zur expliziten Bereitschaft eines Flexibilitätsanbieters mit fest vereinbarten Fahrplänen auf der Übersendung von Fahrplänen durch den Flexibilitätsnutzer. Dagegen umfasst die indirekte Steuerung die Übersendung von variablen Anreizsignalen (z.B. Preisen), nachdem der Anbieter von Flexibilität seine Bereitschaft zur impliziten Steuerung mitgeteilt hat.
Beispielsweise kann die direkte Steuerung durch einen Betreiber eines Verteilnetzes innerhalb einer definierten Netzzelle (Niederspannungszelle im Verteilnetz der Ortschaft) dadurch angefordert werden, dass eine maximale Leistung zugeordnet wird. Je nachdem, ob mit dieser Steuerungsanforderung die Steuerungsauslösung dediziert an einem Anschlusspunkt oder nur als Wert über das gesamte Netzgebiet der Zelle benötigt wird, werden jeweils zwei Beispielverfahren im folgenden Abschnitt zur Steuerungsauslösung und zur Steuerungsverantwortung beschrieben.
Zusätzlich ist die Frage zu beantworten, ob die Bereitschaft eines Anbieters zur impliziten Steuerung mit einer direkten Steuerungsmöglichkeit beantwortet werden kann. Erst in diesem Falle ist die Trennung in die zweite und dritte Steuerungskategorie sinnvoll. Als Beispiel soll hier genannt werden, dass eine mitgeteilte Bereitschaft des Flexibilitätsanbieters zur impliziten Steuerung durch ein direktes Steuerungssignal des Flexibilitätsnutzers im Notfall oder vertraglich unter bestimmten Bedingungen vereinbart übersteuert werden könnte.
Steuerungsauslösung
Die Steuerungsauslösung wurde als vierte Steuerungskategorie definiert und betrifft mit nachfolgenden Beispielen insbesondere die Flexibilitätsauslösung.
Hierbei erfolgt zur Kategorisierung von Mechanismen die Einordnung des die Steuerung auslösenden Akteurs bezüglich der Systemgrenzen. Grundlage ist die Definition eines Systems im räumlichen Zusammenhang, das als Energiezelle mit festgelegten Systemgrenzen zur Umgebung definiert wird. Mit Auslösung der Flexibilitätsbereitstellung innerhalb der definierten Räume durch einen außerhalb dieser Grenzen wirkenden Akteur wird der Begriff der externen Steuerung genutzt. Dies betrifft beispielsweise das als Aggregator wirkende virtuelle Kraftwerk, beim Abruf einer vorher mit dem Betreiber eines Gebäudes, in dem Erzeugungsanlagen installiert sind, vereinbarten Leistungsänderung (Flexibilität) zu einem definierten Zeitpunkt.
Hierzu zählt aber auch die Möglichkeit, dass ein Netzbetreiber von der Leitwarte aus für eine in das Verteilnetz eingelagerte Niederspannungszelle die Maximalleistung an einem Anschlusspunkt oder als Gleichzeitigkeitsquote für den Betrieb von Anlagen in der jeweiligen Netzzelle vorgibt.
Analog wirkt bei der internen Steuerung ein Akteur innerhalb der Systemgrenzen als Auslöser der Flexibilitätsbereitstellung. Als Beispiel sei hier der Abruf einer unvorhergesehenen Energiemenge für einen Ladevorgang des Elektrofahrzeuges aus einer Batterie durch das Energiemanagementsystem des Gebäudes genannt, wenn der Ladevorgang ansonsten zu einer Überschreitung der vereinbarten Spitzenlast am Netzanschluss des Gebäudes führen würde.
Die interne Steuerung träfe ebenso zu, wenn durch eine intelligente Trafostation innerhalb der in das Verteilnetz eingelagerten Niederspannungszelle die Maximalleistung an einem Anschlusspunkt oder als Gleichzeitigkeitsquote für den Betrieb von Anlagen in der jeweiligen Netzzelle vorgegeben wird.
Steuerungsverantwortung
Mit der fünften Steuerungskategorie wird die jeweilige Steuerungsverantwortung herangezogen.
Zum Beispiel kann im Falle der externen Steuerung durch einen Aggregator die Steuerungsauslösung an das Energiemanagementsystem des jeweiligen am Netzanschluss zu steuernden Systems wie im Falle eines Gebäudes oder Stadtquartieres – übergeben werden. Wenn nun das adressierte Managementsystem selbständig über den optimalen Einsatz der Anlagen oder Teilsysteme im Gebäude oder im Stadtquartier entscheidet, um die durch den Aggregator am Netzanschluss beabsichtige Leistungsänderung zu erreichen, soll der Begriff der aktiven Steuerung zur Kategorisierung benutzt werden.
Adressiert dagegen der Aggregator die Nachricht zur Flexibilitätsauslösung direkt an einzelne Anlagen oder Teilsysteme innerhalb des Gebäudes als Systemzelle, wirkt das Gebäude als Zelle mit Managementsystem nicht am Vorgang zur Flexibilitätsauslösung mit. In diesem Falle wird von der passiven Steuerung gesprochen.
Analog kann folgendes Beispiel den Unterschied dieser Steuerungsarten verdeutlichen. Wenn der Netzbetreiber, startend in der Leitwarte des gesamten Verteilnetzes, eine Leistungsbegrenzung an einem Übergabepunkt in die höhere Spannungsebene einer bestimmten, eingelagerten Niederspannungszelle erreichen möchte, existieren folgende zwei Möglichkeiten. Erstens kann eine Anforderung von der Netzleitwarte aus, also extern bezogen auf die Verteilnetzzelle, unmittelbar an eine passende Anlage in der Nähe des Übergabepunktes weitergegeben werden. In diesem Falle wirkt die intelligente Trafostation als Management der Verteilnetzzelle im Rahmen der passiven Steuerung nicht mit.
Wird die Flexibilität in Form einer Leistungsänderung am Übergabepunkt benötigt, ohne Bezug auf eine bestimmt Anlage nehmen zu müssen, kann die Anforderung von der Leitwarte an die intelligente Trafostation gesendet werden, um dort im Rahmen der aktiven Steuerung zu entscheiden, welche passenden Anlagen innerhalb der Zelle gesteuert werden.
Beispiel zum Zusammenwirken der Steuerungskategorien
Eine Regionalnetzbetreiber möchte im Rahmen seiner Verantwortung für eine Regionalnetzzelle an eine eingebettete Verteilnetzzelle einer Ortschaft die Anforderung bezüglich einer Quote zur maximalen Gleichzeitig des Betriebes von bestimmten Anlagengruppe (Nachtspeicherheizungen, Wärmepumpen und Ladepunkte der Elektromobilität) senden. Dabei soll für den Signalweg die kommunikationsbasierte Steuerung genutzt werden, um abhängig von weiteren Einflussfaktoren über die Auswahl der mitwirkenden Anlagegruppen entscheiden zu können.
Vor Adressierung derartiger Steuerungsanliegen findet eine langfristige, vertragliche Allokation von Anlagen statt, zu denen die Anlagenbetreiber ihre Steuerungsbereitschaft auf Basis definierter Leistungszuweisungen zu bestimmten Zeitpunkten vereinbaren, womit die explizite Steuerung ihren Einsatzfall findet.
Der Betreiber des Regionalnetzes beabsichtigt nun, die Steuerungsanforderung mittels direkter Steuerung jeden Tag zu einer bestimmten Zeit an die Verteilnetze als eingelagerte Netzzellen mit festgelegten Leistungen an Übergabepunkten oder maximalen Gleichzeitigkeitsfaktoren für Anlagegruppen in den Verteilnetzen zu senden.
Da die Steuerungsauslösung von außerhalb der Systemgrenzen der Verteilnetzzellen stattfindet, handelt es sich hierbei um eine externe Steuerung.
Mit Versand der Signale direkt an Einzelanlagen innerhalb der Verteilnetze wird die Steuerungsverantwortung durch die Leitwarten der Verteilnetz auch an den Regionalnetzbetreiber abgegeben, womit die passive Steuerung aus Sicht der VNBs stattfindet. Mit Versand einer Quote an Marktsysteme in Verteilnetzen, die dann im Zuge von Handelsverfahren Anlagen der betroffenen Gruppen zur gewünschten Leistungsänderung im Verteilnetz mit festen Leistungsänderungen aggregieren, um die Quote zu erfüllen, wird die aktive Steuerung durch Systeme im betroffenen Netz eingesetzt.
Zur Anwendung auf andere Beispiele im Zusammenhang weiterer Konzepte für Flexibilität sowie der Modellierung des Datenobjektes Flexibilität wird auf folgende Quelle verwiesen.
Quellen
Leimen, den 31. März 2021
Andreas Kießling, energy design