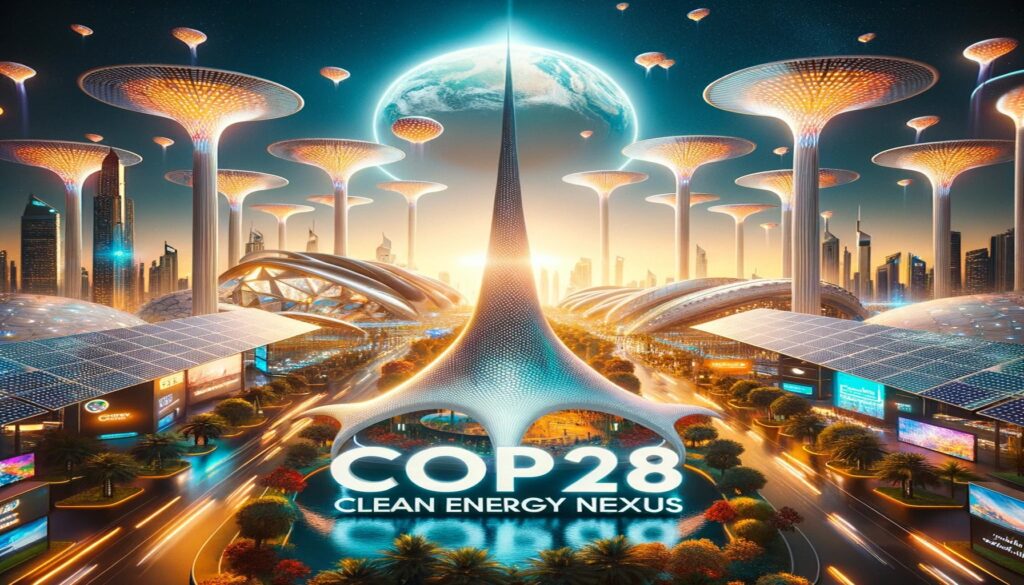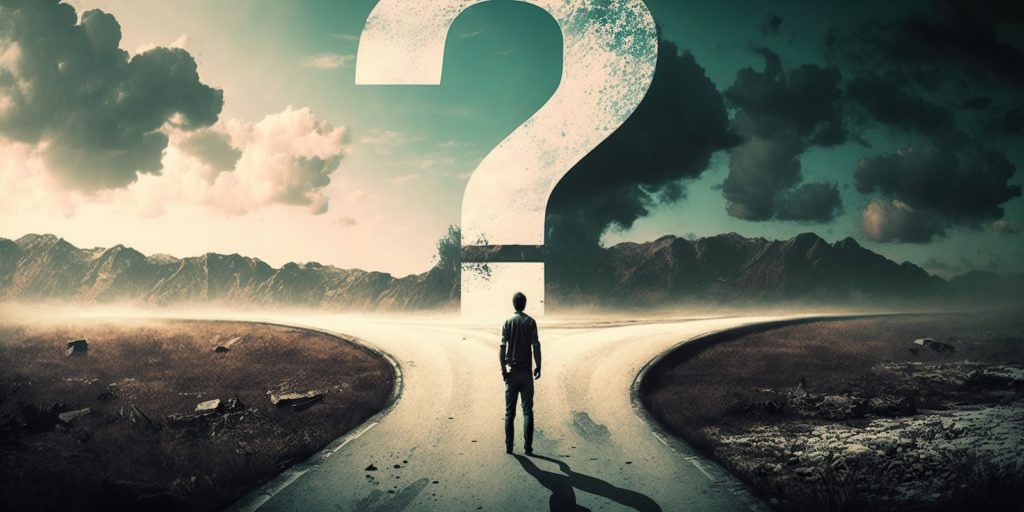Offener Brief an die Bundesnetzagentur
Eigenversorgung aus Sicht der Bundesnetzagentur
Sehr geehrter Herr Homann,
bezogen auf die Datenanalyse der Bundesnetzagentur zu Kosten des Eigenverbrauches Strom vom Dezember 2019 möchte ich mich mit einem öffentlichen Brief direkt an sie als Präsident der Bundesnetzagentur wenden.
Dabei soll an dieser Stelle gleich zu Beginn betont werden: Eigenversorgung mit Energie ist kein Systemfehler! Warum sollte dies deutlich festgestellt werden?
In der genannten Datenanalyse wird formuliert, dass „wirtschaftliche Vorteile, die dem Eigenverbraucher entstehen, für die Allgemeinheit Kosten verursachen“. Weiterhin wird ausgeführt, dass „darüber hinaus aus dem Eigenverbrauch Kosten zu Lasten der Allgemeinheit entstehen, weil die Eigenversorgung zu Ineffizienzen auf den Wertschöpfungsstufen des Stromversorgungssystems führt.“
Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der CSU Josef Göppel schließt daraus, dass die Bundesnetzagentur „Eigenverbrauch als Systemfehler“ einstuft und begleitet dies entsprechend kritisch. Dies kann auch aus Formulierungen des Leiters des Referats für Erneuerbare Energien der Bundesnetzagentur, Peter Stratmann, geschlossen werden. Er schlägt vor, finanzielle Anreize für die Optimierung des Eigenverbrauchs und somit für Heimspeicher radikal zu beschneiden. Er bevorzugt die Volleinspeisung der selbst erzeugten Energie.
Seit den Vorschlägen zu den sogenannten Prosumer-Modellen im Jahre 2020 ist die Diskussion zur Integration der Erneuerbaren beim BMWi sehr stark von den Vorschlägen der Bundesnetzagentur geprägt. Deshalb sei an dieser Stellung die Frage erlaubt, ob es Aufgabe der Bundesnetzagentur ist, Einfluss auf den legislativen Prozess zur Veränderung des regulatorischen Rahmens zu nehmen. Ist es nicht eher nur die Aufgabe der Bundesnetzagentur einen gegebenen regulatorischen Rahmen umzusetzen?
Das Energiesystem der Zukunft sollte nicht aus Sicht des Netzes gestaltet werden, sondern aus Sicht der Chancen eines Transformationsprozesses für die Gesellschaft zum nachhaltigen Wachstum auf Basis von Innovationen und Beteiligungsmöglichkeiten.
Dies möchte ich nachfolgend weitergehend begründen.
Rückblick
Als ehemaliger Stadtrat in der Oberlausitzer Stadt Niesky und als ehemaliger Kreisrat im Niederschlesischen Oberlausitzkreis durfte ich in den 90-er Jahren den Prozess der Liberalisierung begleiten. Mit einer Klage in Dresden erreichte die Stadt Niesky die Übernahme der lokalen Stromversorgung. Im Stadtrat herrscht über alle Fraktionen immer Einigkeit, dass die vollständige Unabhängigkeit der Nieskyer Stadtwerke von externen Beteiligungen im Verbund von Strom‑, Wärme- und Gasversorgung Garant für lokale Gestaltungs- und Wertschöpfungsmöglichkeiten ist.
Als Mitglied der Gesellschafterversammlung lernte ich auch den Ausgangspunkt von Liberalisierung sowie Entflechtung der Netz- und Marktfunktionen im Stromsystem kennen. Die Zielstellung bestand in der Stärkung des Marktes. Die EU betont dabei den kundenzentrischen Ansatz. Nicht das Energiesystem aus Erzeugung, Speicherung und Verbrauch in der Vielfalt der Umsetzungswege in Gebäuden, auf öffentlichen und gewerblichen Arealen, in Städten und ländlichen Regionen dient der verbindenden Netzinfrastruktur. Stattdessen befindet sich die Netzinfrastruktur in der dienenden Rolle gegenüber den anderen Akteuren im Energiesystem.
Dieses Energiesystem wiederum besteht zunehmend aus Eigenerzeugung, Energiespeicherung in Gebäuden, in Stadtquartieren und auf sonstigen Arealen sowie aus neuen Formen der Energienutzung (z.B. Wärmepumpen, Elektromobilität). Daraus resultieren neue Formen des Gebäudedesigns, lokaler und regionaler Energiekonzepte und der Landschaftsentwicklung. In der Folge entwickelen sich Möglichkeiten der Autonomie und Autarkie. Die Übernahme von Gestaltungshohheit wird zum vielfältigen Massenphänomen.
Netzbetreiber als Diener bei der Umgestaltung des Energiesystems
Eigenversorgung mit Energie ist kein Systemfehler, sondern legitimes Gestaltungsrecht in einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Netzinfrastruktur nimmt dabei die angesprochene dienende Rolle ein und ist entsprechend umzubauen. Es geht also nicht primär um die sogenannte System- oder Netzdienlichkeit, auch nicht um die Marktdienlichkeit bei der Gestaltung lokaler Energiesysteme.
Nein, es geht vorrangig um Lebensdienlichkeit und gleichberechtigte Teilhabe bei der Gestaltung von Energiebereitstellung, Speicherung und Energienutzung durch die Bürger, die ländlichen und kommunalen Gemeinschaften sowie durch die Vielfalt kleiner und mittlerer Unternehmen. Somit sei es noch einmal gesagt: Eigenversorgung mit Energie ist kein Systemfehler, sondern ein Recht, dass der notwendige Umbau der Netzinfrastruktur zu gewährleisten hat.
Übrigens korrespondiert dieser Weg mit den EU-Richtlinien zu Erneuerbaren Energien und zur Umgestaltung des Energiemarktes unter den Begriffen Eigenversorgung, gemeinschaftliche Eigenversorgung, Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften sowie Bürgerenergiegemeinschaften. Deutschland hinkt bei der Umsetzung dieser Richtlinien zurück. Leider ist festzustellen, dass gerade die Bundesnetzagentur die Bestrebungen zur Eigenversorgung skeptisch beurteilt und eher behindert. Nachfolgend soll deshalb beleuchtet werden, warum Eigenversorgung eine große Chance für die gesamte Gesellschaft ist.
Veränderung der Wertschöpfung
Erneuerbare Energien bieten Chancen zur Energiegewinnung, Speicherung und Nutzung in allen Lebensbereichen. Dies ermöglicht neue Gestaltungsansätze für private und öffentliche Gebäude, Stadtquartiere, gewerbliche und industrielle Areale, Städte und ländliche Regionen.
Städte spielen eine zentrale Rolle, um neue Formen des Designs auf Basis erneuerbarer Energien, neuer Werkstofftechnologien sowie der Digitalisierung zu verbreiten.
Gleichzeitig führen Klimawandel, Vernetzung und die Globalisierung zu neuen Gefahren für die sichere Funktion der Stadt. Dies zeigt die zunehmende Anzahl der Cyber-Angriffe wie auch die Corona-Pandemie. Die Stadt muss sich mit autonomen Funktionen auf Gefahren einstellen. Die Stadt der Zukunft wird nicht autark funktionieren. Sie kann aber mittels digitaler, energetischer und stofflicher Kreisläufe autonom wirken, einen höheren Grad an Resilienz entwickeln sowie mit der Umgebung interagieren.
Möglichkeiten zu autonomen Energiekonzepten schaffen Anreize zur Selbstgestaltung sowie zur kommunalen und regionalen Wertschöpfung. Sie befördern nachhaltige Entwicklung und verändern wirtschaftliches Handeln. Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Hermann Scheer bezeichnete lokale Energie aus Photovoltaik als Mittel zur Entschuldung der Kommunen.
Anderseits erhöhen dezentrale Gestaltung und Formenvielfalt die Komplexität des Energiesystems. Konzepte zur Komplexitätsbeherrschung umfassen zwingend die autonome Regelung in Teilbereichen des Gesamtsystems bei gleichzeitiger Integration in den Verbund. Dies erhöht die Widerstandsfähigkeit der Energieinfrastruktur. Auf dieser Basis widmete sich das Schaufensterprojekt C/sells im SINTEG-Programm der zellulären Systemarchitektur zur Eigengestaltung auf Basis von autonomen, im Verbund agierenden oder im Notfall auch autarken Konzepten.
Partizipation — also Beteiligung — ist der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende. Dabei umfasst dieser Begriff nicht nur Mitsprache. Er beschreibt auch Eigengestaltung, gemeinschaftliches Wirken sowie die Neubestimmung des Verhältnisses lokaler, regionaler und globaler Formen von Energiezugriffen.
Eine wichtige Erkenntnis aus vielfältigen Projekten ist der Nutzen, den eine umfassende Ausprägung von Beteiligungsformen an der Energiewende mit sich bringt. Dadurch verändert sich die Gesellschaft, schafft Sprunginnvationen und generiert neues Wachstum.
Zielbestimmung auf Basis einer politischen Diskussion
Eigenversorgung als Systemfehler zu bezeichnen kann somit nur auf einem eingeengten Blickwinkel beruhen und konserviert ausschließlich bisherige Strukturen. Eigenversorgung mit Energie ist kein Systemfehler, sondern Chance für die Gesellschaft, um eine nachhaltige Zukunft mit Wachstum zu verbinden.
Um das eigentliche Problem offenzulegen, das letztendlich Ursache der zögerlichen Energiewende in Deutschland ist, müssen wir noch einmal ein Stück zurücktreten.
Zu den grundlegenden Zielen bezüglich der Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen in die Atmosphäre, des Ausbaus der Erneuerbaren Energiegewinnung und zur Steigerung der Effizienz beim Energieeinsatz besteht weitgehend Einigkeit. Zur Wegbestimmung folgt schnell die Uneinigkeit bei der Bestimmung des Zukunftsszenarios. Es stellt sich die Frage, ob es in der Gesellschaft sowie bei den politischen Entscheidern den Willen gibt, aus einem zentralen System eine dezentralere Architektur aufzubauen. Diese Frage wird in Deutschland in Folge des vom BMWi geförderten Programm E‑Energy seit 2008 diskutiert und ist anscheinend immer noch nicht entschieden.
Der Widerstand gegen ein deutlich dezentraleres System, in dem Eigenversorgung kein Systemfehler ist, zeigt sich auch bei der fehlenden Bereitschaft, im Erneuerbaren-Energien-Gesetz als auch im Energiewirtschaftsgesetz die EU-Richtlinien zu Eigenverbrauch, gemeinschaftlichen Eigenverbrauch, Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften als auch Bürgerenergiegemeinschaften vollständig umzusetzen. Insofern scheint es notwendig, die Frage nach dem Zukunftsszenario des Energiesystems zu stellen, klar zu beantworten sowie die Umsetzung diesbezüglicher EU-Richtlinien zu prüfen.
Dabei ist der Fokus nicht nur auf das sogenannte energiewirtschaftliche Dreieck mit CO2-Reduktion, Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu richten. Wie schon ausgeführt ist Partizipation der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende. Statt des energiewirtschaftlichen Dreiecks sollte uns das energiewirtschaftliche Quadrat leiten.
Es geht nicht zuerst um Effizienz, sondern um die Effektivität der Zielerreichung. Die Ausbauziele für Erneuerbare Energie werden durch Beteiligung der Vielfalt der Gesellschaft effektiver erreicht. Deshalb geht es im zweiten Schritt um die Gestaltung des Rahmens für die oben genannten Punkte der EU-Richtlinien. Eine Systemarchitektur aus Zellen autonomer Gestaltungshoheit in Microgrids (Gebäude, Quartiere, Areale, ländliche Regionen) benötigt zusätzlich zur dezentralen Erzeugung zur Komplexitätsbegrenzung auch dezentrale Regelungsstrukturen und dezentrale Informationssysteme. Der regulatorische Rahmen ist also eher zu entschlacken und in regulatorischen Innovationszonen zu testen. Die Effizienz der Lösung kann dann bewertet werden, wenn der effektive Weg zum Ziel in der Gesellschaft auf Basis einer politischen und nicht technischen Diskussion gewählt wurde.
Systembewahrer
Existiert ein Gleichgewicht bei der Verbreitung von Positionen? Anstrengungen für mehr Bürgerenergie stehen starke Gegner zur Konservierung des bisherigen Systems gegenüber. Diese Gegner werden oft mit der gesamten Energiewirtschaft gleichgesetzt. Doch diese These wird hier nicht gestützt. Stadtwerke und Regionalversorger sind auch Treiber der Veränderungsprozesse. Sie sehen ihre Zukunft im Infrastrukturbetrieb auf Basis der Digitalisierung. Dazu gehört das wachsende Geschäft aus Energiedienstleistungen, das Verluste aufgrund abnehmender Energielieferungen ausgleichen soll. Diese Akteure stellen Energiemanagementsysteme für Gebäude und Stadtquartiere bereit, um zelluläre Lösungen zu ermöglichen. Somit entwickeln sich Unternehmen der klassischen Energiewirtschaft vom Versorger zum „Umsorger“.
Der Begriff der Versorgung umfasst ein gewisses Maß an Unmündigkeit. In der Tat war das bisherige Energiesystem über 100 Jahre ein Versorgungssystem ohne Selbstgestaltung. „Strom kommt aus der Steckdose“ war der Slogan. Anderseits möchte der mündige Mensch seine Lebensweise eigenständig gestalten, aber dabei entsprechend seinen Wünschen unterstützt – umsorgt – werden und den Lebenskomfort erhöhen. Für den notwendigen Lebensraum soll dabei die Gestaltungshoheit übernommen werden. Menschen erwarten die Lebensdienlichkeit der im Lebensraum benötigten Lösungen und nicht die von der Energiewirtschaft und zugehörigen Institutionen verlangte System‑, Netz- und Marktdienlichkeit.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich Interessenträger eines zwar erneuerbar umgestalteten, aber weiterhin zentralen Systems. Auch Günther Oettinger sprach sich als EU-Kommissar gegen dezentrale PV-Erzeugung aus und forderte stattdessen die umfangreiche Nutzung von Offshore-Wind entlang der Atlantikküste Europas, Solarenergie mit dem Projekt Desertec in Nordafrika sowie neue Höchstspannungs-Leitungen mit Gleichstrom und Pumpspeicherkraftwerke in Norwegen. Die größten Unternehmen der Energiewirtschaft sprechen sich tendenziell eher für zentrale Lösungen aus als Stadtwerke und Regionalversorger. Die finanziell stärksten Unternehmen besitzen die Ressourcen für Öffentlichkeitsarbeit, um dezentrale Lösungen in ein schlechtes Licht zu rücken. Eigenversorgung wird als unsolidarisch diskreditiert und mit bewusster Falschdarstellung als Ursache für die explodierende EEG-Umlage dargestellt. Marktmacht wird genutzt, um bei Vertretern der Politik und der Behörden intensiv vorzusprechen.
Systemveränderer
Auf der anderen Seite hat die Vielfalt der Vertreter dezentraler Lösungen keine starke Lobby. Der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete Josef Göppel schließt daraus, dass nur aktive Präsenz am Energiemarkt den Kleinerzeugern Einfluss als politischen Faktor sichert.
Dafür wird die Bewusstseinsbildung bezüglich der Chancen dezentraler Energiegewinnung im Design der Gebäude, Quartiere, Landschaften benötigt. Bisherige Leuchtturmprojekte waren längst nicht geeignet, dieses Ziel zu erreichen, da sie sich in einer begrenzten Gemeinschaft bewegen. Es werden großfläche, dauerhaft angelegte Real- und Experimentierumgebungen in Verbindung mit einer Informationskampagne des Landes benötigt.
Dabei ist die gesellschaftliche Entscheidung auf Basis eines politischen Diskurses zu den Folgen der Beibehaltung des bisherigen, zentralen Versorgungskonzeptes und der Gestaltung eines dezentralen und komplexeren Systems notwendig.
Aktuell wird die Diskussion in Deutschland eher von einer negativen Kommunikation bezüglich der technischen Probleme getragen. Andere Staaten sehen eher die Chancen und unterstützen die Aufbruchstimmung für Sprunginnovationen.
Die Fragestellungen sind dabei natürlich individuell und komplex. Deshalb werden vielfältige Experimentierumgebungen und Musterlösungen benötigt, die durch langfristig aufgestellte, institutionelle Unterstützung verbreitet werden, um das Bewusstsein für Chancen in die Breite der Gesellschaft zu tragen.
Auch sind die notwendigen Vorhaben nicht durch jeden finanziell zu leisten. Gerade deshalb werden nicht nur Eigenverbrauchslösungen, sondern Energiegemeinschaften benötigt. Leider werden die in den genannten EU-Richtlinien genutzten Begriffe zu gemeinschaftlicher Eigenversorgung und zu Energiegemeinschaften im Rahmen nationaler Gesetzgebungsprozesse weitgehend ignoriert.
Schlussfolgerungen
Die Bundesnetzagentur sollte nicht auf Grundlage der aktuellen Regulierung gegen Veränderungsprozesse argumentieren, die insbesondere mit den Begriffen dezentrale Energiesysteme, Prosumer, Autonomie in Energiezellen, Energiespeicher und Flexibilität verbunden sind. Stattdessen ist der gesellschaftliche Prozess zum Umbau des Energiesystems in einem partizipativen Prozess sowie das resultierende Verfahren zum Umbau des legislativen und regulatorischen Rahmens zu beobachten, um die Veränderungsprozesse zur Regulatorik im Rahmen der Bundesnetzagentur zügig abbilden zu können.
Ein erfolgreicher Wandel kann nur gelingen, wenn technische und zentral gelenkte Detailregulierung nicht das Primat vor der Freisetzung von Sprunginnovationen auf den unterschiedlichen Ebenen der Gesellschaft hat. Nachfolgend werden deshalb drei Schwerpunkte zur Begründung von Eigenversorgung in dezentralen Energiesystem zusammengefasst.
Widerstandsfähigkeit durch zellulären Verbund
Von Beruf Kernphysiker ist mir bewusst, dass sich ein nachhaltiges Energiesystem der Zukunft weiterhin rein zentral aufbauen lässt. Aus meiner Sicht wird auch die Kernfusion zukünftig eine wichtige Rolle spielen. Der weiterhin wachsende Energiebedarf der Menschheit bei einem Weg zum nachhaltigen Wachstum erfordert die Diversifierung der Wege zur Energiegewinnung auch mit großtechnischen Anlagen.
Aber gerade die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie anfällig rein zentral organisierte Systeme sind. Flexibilität und Autonomie werden benötigt, was letztendlich zur Dezentralisierung in einer Art zellulärem Verbund führen muss. Zentral organisierte Systeme besitzen weniger Widerstandskraft als dezentrale Systeme, die mit autonomen und autarken Formen der Gestaltung sowie gemeinsamen Regeln im Verbund wirken. Wir benötigen also die Vereinigung von zentralen Großanlagen und dezentralen Lösungen in einem Systemverbund, dem zellulären Energieorganismus.
Nachhaltiges Wachstum mit neuen Möglichkeiten der Wertschöpfung
Autonomie und Verbundenheit gehören zusammen, denn erst der komplexe Organismus ermöglicht Flexibilität und Emergenz – also die Entwicklung neuer Eigenschaften und Möglichkeiten in einem System. Aus technologischer Sicht ist Emergenz mit dem Auftreten von Sprunginnovationen verbunden. Sprunginnovationen bilden die Grundlage für neues wirtschaftliches Wachstum, das auf nachhaltiger Entwicklung basiert. Somit sind dezentrale Lösungen und Eigenversorgung auch Mittel zu Wertschöpfung in den Regionen sowie bei klein- und mittelständischen Unternehmen. Es geht also nicht um die Beseitigung von Ineffizienzen, wie in der anfangs genannten Datenanalyse der Bundesnetzagentur ausgeführt, sondern um die Umgestaltung und Verbreitung der Wertschöpfungsmöglichkeiten.
Neues Design der Gebäude, Städte und Landschaften der Zukunft
Die Übernahme der Gestaltungshoheit bezüglich der eigenen Energiekreisläufe eröffnet neue Möglichkeiten für das Design von Gebäuden und Stadtquartieren sowie für die Entwicklung von Städten und Landschaften. Das Stadtbild der Zukunft wird sich verändern. Diese Aussichten bieten wiederum bezüglich der notwendigen Lernprozesse neue Chancen für Architektur, Landschaftsgestaltung, für neue Berufsbilder und neue Formen des Zusammenwirkens von Akteuren bei Planung, Bau und Betrieb von Gebäuden und Infrastrukturen.
Unser Standpunkt basiert auf der Überzeugung, dass das Recht auf informationelle und energetische Selbstgestaltung jedem Akteur der Gesellschaft als Grundrecht zusteht, denn Energie und Information sind die Grundlage von Leben.
Der Zugriff auf Energie und Information schafft Arbeit und ermöglicht nachhaltiges Wachstum.
Es gibt keine Bürgerpflicht, sich Versorgen lassen zu müssen, sondern das Recht und die Freiheit zur Selbstgestaltung.
Diese beiden konträren Standpunkte für zentral oder partizipativ, dezentral organisierte Systeme sind nicht wissenschaftlich zu beweisen, sondern entsprechen zwei Wegen gesellschaftlicher Entwicklung. Aber, Eigenversorgung mit Energie ist kein Systemfehler.
Wir müssen uns entscheiden!!
Leimen, den 20. April 2021
Andreas Kießling, energy design