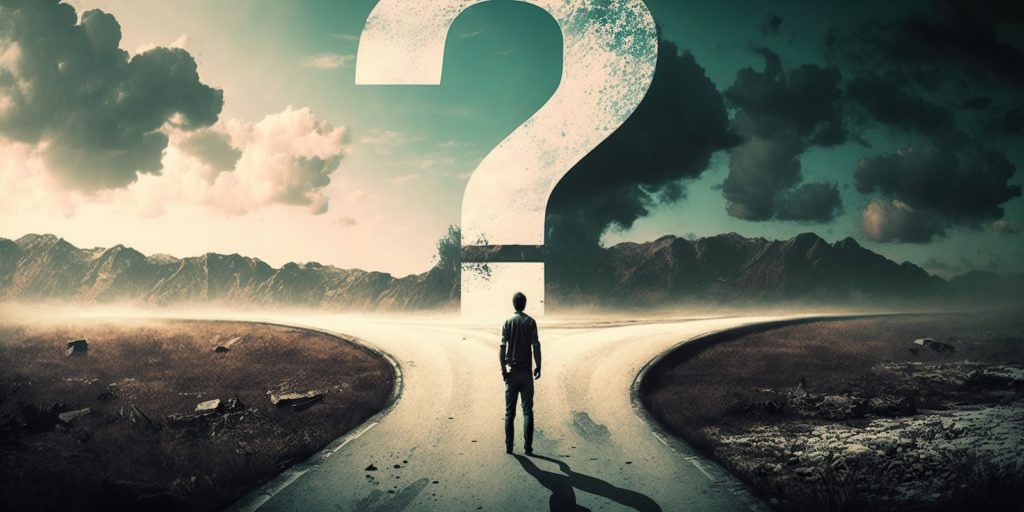Aufbruch zur Übernahme von Gestaltungshoheit
Die Energiewende bietet sowohl Chancen für neues Wachstum als auch zur Neudefinition der Gestaltung von Gebäuden, Quartieren und regionalen Landschaften unter Einbeziehung von Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel. Leider werden aktuell in der politischen Diskussion vorrangig die Schwierigkeiten beim Umbau des Energiesystems diskutiert. Das Umbautempo wird entgegen den Notwendigkeiten zum Klimaschutz niedrig gehalten. Der politischen Elite mangelt es an der Fähigkeit, die neuen Chancen für die Gesellschaft mit Übernahme von Gestaltungshoheit durch Viele auf Basis von Inspiration und Innovation zu begreifen und zu befördern.
Damit verliert Politik aber den Kontakt zum gesellschaftlichen Handeln. Die Hoheit zur Planung lokaler Energiesysteme wird durch Menschen, Unternehmen, Kommunen und Regionen längst übernommen. Vielfältige Beispiele zur Anwendung von Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel entwickeln sich.
Die neue Beitragsreihe im Blog „Dokumentation der Energiewende“ verfolgt das Ziel, diese Beispiele in das breite Bewusststein der Öffentlichkeit zu bringen. Im hier vorliegenden Artikel wird die Umsetzung der Energieautarkie anhand von zwei Mehrfamilienhäusern in Cottbus vorgestellt. Der technische Vorstand des Betreibers dieser Gebäude, Arved Hartlich von der eG Wohnen 1902, stellte sich freundlicherweise für ein Interview zur Verfügung, um das Konzept zu erläutern und durch die Objekte zu führen.
Bevor wir auf das Gebäudekonzept eingehen, soll kurz das Verhältnis von Autonomie, Autarkie sowie das solidarische Zusammenwirken bei der Gestaltung beleuchtet werden.
Peter Eckardt definiert Gestaltungsmittel, in der bildenden, bauenden und angewandten Kunst wirksam werdende Dimensionen, Übereinstimmungen, Differenzen, Kontraste, Grenz- bzw. Richtungswerte, die in einem jeweils gegebenen Zusammenhang (Darstellungsform) oder auch isoliert eine Gestaltung bewirken.
Um nun Autonomie und Autarkie in Gebäuden und Landschaften zu schaffen, benötigen wir zuerst die Definition von Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel.
Bedeutung von Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel
Die Bestrebungen zur Autonomie und Autarkie sind ein legitimes Gestaltungsinteresse des Einzelnen oder von Gruppen. Gleichzeitig verfolgen Menschen als soziale Wesen gemeinschaftliche Interessen sowie zeigen die Fähigkeit zur gegenseitigen Unterstützung. Somit beschreibt der Begriff Solidarität die Bereitschaft der Einzelnen zu kooperieren. In diesem Kontext ist es notwendig, die Begriffe Autonomie und Autarkie zu definieren.
Mit Autonomie wird das Wechselspiel zwischen Eigengestaltung und Zusammenwirken beschrieben. Die Gestaltungshoheit in Gebäuden, Arealen oder regionalen Landschaften als Systemgrenze Einzelner oder von Gemeinschaften wird übernommen. Aber dies findet gleichzeitig im Verhältnis zur Systemumgebung als einbettendes System statt, also in Beziehung oder in Solidarität zu Anderen. Der Grad dieser Beziehung ist einerseits frei gewählt und gestaltet, wird aber auch durch die Gesellschaft bestimmt.
Die Autarkie eines Systems bedeutet eine extrem vom Außen abgegrenzte Existenz in dem Sinne, dass der oder das Andere in der Systemumgebung nicht mehr nötig ist. Dieser Weg wird teilweise von der einbettenden Gesellschaft als unsolidarisch bezeichnet. Anderseits sind verbundene, zentral organisierte Systeme bei hohem Grad der Vernetzung vielfältigen Gefahren ausgesetzt. Ein Ausfall der Energie- und Wasserversorgung auf zentraler Ebene führt in der Regel zum Ausfall in den Teilsystemen. Insofern ist das Bestreben nach Autarkie auch ein Beitrag, wichtige Grundfunktionen in Gebäuden, Städten und Regionen aufrechtzuerhalten. Dies unterstützt wiederum die Funktion des Ganzen. Aber auch in dünn besiedelten Regionen und auf Inseln sind autarke Lösungen oft kostengünstiger als zentral organisierte Infrastrukturen.
Sowohl mit Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel wird Unabhängigkeit in unterschiedlichem Grad ausgeprägt. Dabei ist sich der Autonome seiner grundsätzlichen Abhängigkeit von Beziehungen nach außen bewusst, während der Autarke diese Verbindung in realer Weise oder auch nur gewünscht nicht benötigt.
Energieautarkie in einem Cottbuser Stadtquartier der Wohnungsgenossenschaft
Ende September fand in Cottbus der Besuch der ersten energieautarken Mehrfamilienhäuser statt, die von der Wohnungsgenossenschaft betrieben werden. In diesen Objekten wird den Wohnungsmietern über fünf Jahre eine stabile Pauschalmiete garantiert, in der Wohnen, Wärme und Strom als Festpreis enthalten sind. Der größte Teil der benötigten Energie wird hierbei mit Solarwärme- und Solarstrom-Anlagen erzeugt. Bekannt sind natürlich entsprechende Lösungen in Einfamilienhäusern. Im Mehrfamilienhaus ist dieses Konzept aufgrund vielfältiger bürokratischer Hürden neu. Auf diese Hürden werden wir noch eingehen, doch soll an dieser Stelle zuerst das technische Konzept beleuchtet werden.
Die grundsätzliche Idee für diese Häuser wurde von Professor Timo Leukefeld, der an der Technischen Universität Freiberg lehrt, entwickelt. Die weitere Ausarbeitung erfolgte in Gemeinschaftsarbeit zwischen der Cottbusser Wohnungsgenossenschaft – der eG Wohnen 1902 — und der HELMA Eigenheimbau AG. Der energetische Ansatz wurde dabei zuerst im Rahmen eines Simulationssystems konzipiert und auf seine Funktion über die gesamte Periode eines Kalenderjahres von der FI Freiberg Institut GmbH analysiert.
An dieser Stelle ist eventuell über den zum Gebäudekonzept genutzten Begriff Energieautarkie zu diskutieren. Die Gebäude sind über den größten Zeitraum eines Kalenderjahres energetisch unabhängig, benötigen aber zumindest in den Wintermonaten zusätzlichen Heizebedarf und Strom. Aber bezüglich des Grades der Energieautonomie erreichen die Objekte eine Eigenversorgungsquote von ungefähr 70 Prozent für Strom und Wärme.
Grundsätzlich ähneln sich die technischen Konzepte für autonome Gebäude. In Cottbus wurde aber neben der autonomen Stromversorgung besonderer Wert auf einen hohen Grad der eigenen Wärmeversorgung in Verbindung mit der Warmwasseraufbereitung sowie auf Kühlung im Sommer gelegt.
Konzept zur Stromversorgung
Die Stromversorgung dient zwei viergeschossigen Mehrfamilienhäusern (3 Vollgeschosse plus Dachstudio) mit zwei 5‑Raum-Wohnungen, zwei 2‑Raum-Wohnungen sowie zehn 3‑Raum-Wohnungen. Die Gesamtwohnfläche in jedem der zwei als Effizienzhaus 55 geplanten Gebäude beträgt 600 Quadratmeter, wobei die Wohnflächen je Wohnung zwischen 50 und 130 Quadratmeter liegen.
Die Stromversorgung beider Gebäude basiert auf jeweils einer Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 30 Kilowatt. Das Dach wurde zur Maximierung der Energieausbeute auch bei tief stehender Sonne südlich mit einer 50 Grad steilen Dachschräge ausgerichtet.
Zur Erreichung des geplanten Autarkiegrad der Stromversorgung in Höhe von 75 bis 80 Prozent werden Lithium-Ionen-Batterien mit einer nutzbaren Kapazität von 42 Kilowattstunden pro Haus eingesetzt.
Zur Beladung der Elektrofahrzeuge der Mieter im Wohnquartier dieser beiden Gebäude wurden zwei Ladesäulen bereitgestellt. Um aber den hohen Autarkiegrad der Gebäude zur Stromversorgung der Wohnungen nicht zu reduzieren, erfolgt die Versorgung der Ladesäulen über einen öffentlichen Stromanschluss.
Überschüsse der Strom- und Wärmeerzeugung werden zuerst in das die zwei Objekte einscließende Wohnquartier abgegeben. Das gesamte Grundstück des Wohnquartiers befindet sich im Eigentum der Wohnungsgenossenschaft, womit die Lösung ein geschlossenes Netz einer privaten Energiezelle im Quartier bildet. Durch das Verfahren der Eigenverbrauchsmaximierung wird die Energieeinspeisung in das externe Netz konzeptionell vermieden. Das Gesamtsytstem trägt somit zur Netzentlastung in Zeiten hoher Solarstromerzeugung bei.
Die wärmeseitige Vernetzung der autonomen Gebäude mit dem umgebenden Wohnquartier der Genossenschaft auf Basis der nachfolgend beschriebenen Wärmekonzeptes führt weiterhin zu einem höheren Nutzungsgrad der Solarthermie und erbringt somit einem zusätzlichen Nutzen für die Bewohner des Quartiers.
Wärmekonzept
Zur Erreichung eines hohen Autonomiegrades bei der Wärmeversorgung wurde zuerst Wert auf ein optimal dämmendes Mauerwerk gelegt. Deshalb erfolgte der Einsatz monolithischer Ziegel zur äußeren Dämmung und teilweise von Mauerwerksziegeln zur Erhöhung der inneren Wärmespeicherfähigkeit. Damit konnte der Wärmebedarf auf 18 KWh pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr bei 21 Grad durchschnittlicher Raumtemperatur im Gebäude begrenzt werden. Diesen Bedarf deckt weitgehend eine Solarthermieanlage auf der Südseite des Daches mit einer Kollektorfläche von 100 Quadratmetern.
Das solare Wärmeangebot sollte eine Eigenversorgungsquote für Heizung und Warmwasser in Höhe von 62 bis 67 Prozent ermöglichen. Dafür wurde ein großer Wärmespeicher als Schichtenspeicher mit einem Volumen von 24 Kubikmetern im Zentrum jedes Gebäudes errichtet.
Die Warmwasseraufbereitung erfolgt über eine Frischwasserstation. Hiermit wird zum Beispiel Wärme am Anschluss der Waschmaschine über den Heizungskreislauf übertragen, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Die Funktion entspricht im Prinzip einem Durchlauferhitzer. Mit dem vorgewärmten Wasser wird Strom zum Heizen beim Waschvorgang gespart. Eine Frischwasserstation gilt gegenüber einem Durchlauferhitzer als effizienter.
Zusätzlich erhöhen Anlagen zur Wärmerückgewinnung die Effizienz der Wärmenutzung in den Wohnungen. Durch eine Lüftungsanlage kann der Energieinhalt der Abluft genutzt werden, um die Zuluft zu temperieren. In der kalten Jahreszeit wird die Zuluft erwärmt und in der warmen Jahreszeit gekühlt. Bei der zunehmend dichten Bauweise von Gebäuden dienen die Rückgewinnungsanlagen auch dazu, Feuchtigkeit abzuführen und der Schimmelbildung vorzubeugen.
Zur Deckung des restlichen Wärmebedarfes, insbesondere im Winter, dient eine Gas-Brennwerttherme zur Zusatzbeheizung des oberen Wärmespeicherbereiches.
Schlussendlich unterstützen für vier Erdsonden mit einer Bohrtiefe von 75 Metern die zusätzliche Kühlung der Gebäude in den warmen Jahreszeiten. Mit Unterstützung der Erdwärme kann die Temperatur in den Wohnungen im Sommer um durchschnittlich 1,5 bis 2 Grad gesenkt werden.

Der Wärmespeicher; Quelle: www.cottbus-sonne.de
Projektpartner
Das Ziel des Forschungsprojektes „Eversol-MFH“ besteht in der Untersuchung der zwei vernetzten, mit hohem Anteil an Solarenergie versorgten Mehrfamilienhäuser. Neben der technisch-wirtschaftlichen Evaluierung des Energiekonzepts spielt auch die soziologische Begleitung des vom BMWi geförderten Projekts eine wichtige Rolle. Die oben genannten Grade der Eigenversorgung für Heizung und Warmwasser sowie Strom stellen eine kleine Revolution dar. Dabei kommt auch ein neuartiges Mietmodell unter Einschluss pauschaler Betriebskosten zum Einsatz. Die dafür nötige Planungssicherheit wird durch die hohen Eigenversorgungsquoten erreicht.
Das Konzept wird durch ein umfassendes energetisches Monitoring der Gebäude bis 2021 geprüft. Dies erfolgt mittels Gebäude- und Quartierssimulationen am Lehrstuhl für Technische Thermodynamik (Prof. Dr.-Ing T. Fieback) der TU Bergakademie Freiberg.
Das Freiberg Institut als Partner der Universität beschäftigt sich mit dem Thema Pauschalmietmodelle und der Analyse der gewonnenen Daten aus dem Monitoring.
Neben energetischen, rechtlichen und ökonomischen Fragen wird die soziologische Begleitung der Mieter und die Frage nach den Auswirkungen pauschaler Mietmodelle auf das Wohn- und Energieverbrauchsverhalten eine wichtige Rolle spielen. Die Ergebnisse aus dem Projekt werden intensiv mit der Wohnungswirtschaft diskutiert. Weiterhin besteht eine Zusammenarbeit mit den Verbänden der Wohnungswirtschaft VSWG e.V. und GdW. Hierbei soll einerseits die Verbreitung der Erkenntnisse innerhalb der Branche als auch eine Betrachtung aktueller Fragestellungen aus der Wohnungswirtschaft innerhalb des Projekts und dessen Zielsetzungen erfolgen.

Workshop: Pauschalmiete in der Wohnungswirtschaft (Quelle: tradu4you)
Ansprechpartner: Monitoring — Dr.-Ing. Thomas Storch; Pauschalmiete — Konrad Uebel (mail@freiberg-institut.de)
Politischer Rahmen für Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel
Die rechtlichen Hürden für autonome Lösungen wurden schon angesprochen. Die Bundespolitik befürchtet den Verlust eines solidarischen und seit über 100 Jahren zentral organisierten Systems. Die Nutznießer der bisherigen Organisation des Energiesystems stützen diese These. Änderungen gesetzlicher Rahmenbedinungen zur Energiewende legten in den letzten Jahren dezentralen Lösungen zunehmend Steine in den Weg. Dies trifft sowohl für Konzepte der Mieterversorgung, für die Bildung von Energiegemeinschaften als auch für Quartierslösungen mit Gemeinschaftsanlagen zu. Selbst im nicht öffentlichen Raum bestehende und bestimmte Anlagengrößen überschreitende Installationen werden mit den vollständigen Abgaben oder entsprechend hohen Anteilen belegt. Dies behindert die Wirtschaftlichkeit von Gemeinschaftsanlagen. Erschwerend wirkt, dass die Nutzung derartiger Anlagen in Quartieren bei Überschreitung bestimmter Leistungsgrenzen schnell mit den gesetzlichen Pflichten eines Energieversorgers verbunden ist. Die dabei entstehenden komplexen Prozesse sind nicht durch Hausgemeinschaften oder Wohnungswirtschaft umzusetzen.
Durch Experten wird die Notwendigkeit der Umgestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen im Bereich der Energieversorgung für den Eigenbedarf, für Mieter sowie für andere Formen von Gemeinschaften gefordert. Im Hinblick auf den notwendigen Umbau des Energiesystems bieten Autonomie und Autarkie als Gestaltungsmittel hohe Chancen, den Anteil der Erneuerbaren Energien in den Städten und Gemeinden schnell zu erhöhen. Die Energiepotentiale auf Basis der Nutzung der Gebäudedächer und ‑fassaden sind nur in geringem Maße erschlossen. Die Möglichkeiten des Gebäudeentwurfes zum Einsatz dieser Potentiale sind heute technisch vielfältig möglich. Der politische Rahmen zur Beförderung der Nutzung fehlt.
Eigeninitiative und Zusammenwirken als Gestaltungsmittel für den Klimaschutz
Der Gedanke zur Energieautonomie fand im Cottbuser Stadtquartier der Wohnungsgenossenschaft „eG Wohnen 1902“ seine Umsetzung. Die Gebäude werden seit Anfang 2019 vermietet und genutzt. Die Mieter freuen sich über die Sicherheit eines fixen Energiepreises über fünf Jahre um Umfeld steigender Energiepreise. Was dies für den Energieverbrauch in den Gebäuden bedeutet, ist in den nächsten Jahren zu untersuchen. Hieran beteiligen sich die Technische Universität Freiberg und das Freiberg Institut.
Teilweise befinden sich derartige Lösungen heute noch im gesetzlichen „Graubereich“ und ihre langfristige Nutzung ist unklar. Die Mieter haben einen festen Energieliefervertrag mit dem Betreiber zur Nutzung der autonomen Energietechnik. Sollte sich der Rahmen zu Ungunsten derartiger dezentraler Energiegemeinschaften entwickeln, droht die Aufhebung der angewendeten Abrechnungsmethode. Hier ist der Gesetzgeber gefordert.
Die Bundesregierung adressierte mit dem Klimaschutzpaket auch die Steigerung der Energieeffizienz und das Energiemanagement in den Gebäuden. Das Interesse an derartigen Gestaltungsmaßnahmen kann aber nur dann breit entfaltet werden, wenn Autonomie und Akzeptanz als Gestaltungsmittel aktiviert wird. Aktivitäten in Cottbus und an anderen Standorten sind also zu befördern und nicht als Verletzung der Solidarität herabzuwürdigen. Dies fordert auch eine EU-Direktive zur Beförderung von lokalen Energie-Communities, zu deren Umsetzung Deutschland verpflichtet ist.
Andreas Kießling und Konrad Uebel, Leimen, 24. Oktober 2019