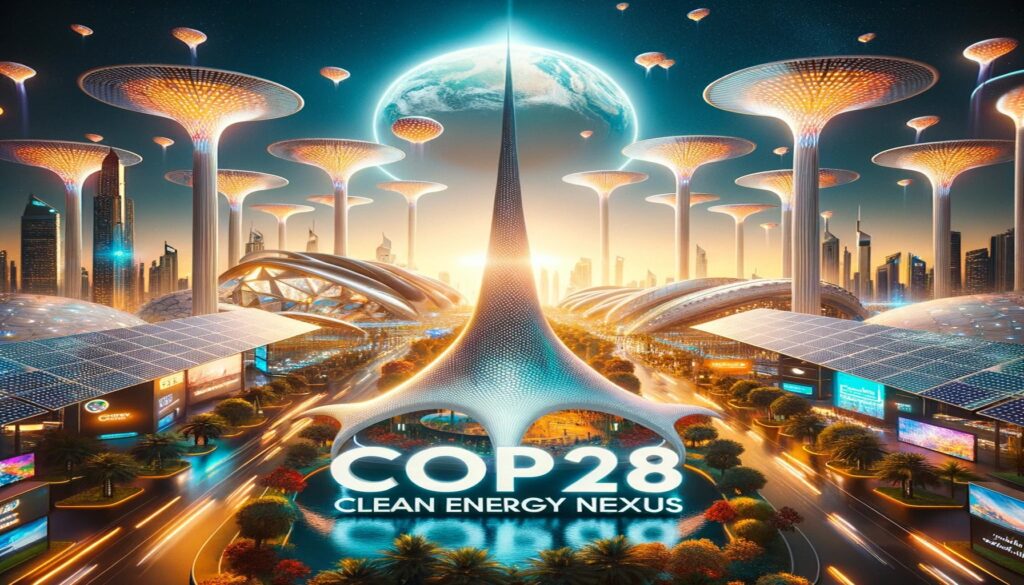Zukunftsbild einer gedeihenden Gesellschaft
Möglichkeiten zum Gedeihen eröffnen statt Weltsichten verfestigen
Multipolare Beziehungen zwischen Ländern und Regionen der Welt, unterschiedliche politische Hintergründe und Kulturen sowie Verschiedenheit der Umweltbedingungen und Ressourcen erfordern Kommunikationsfähigkeiten, Kompromissbereitschaft und die Fähigkeit zur Betrachtung anderer Denkschulen, die nicht in die eigene Weltsicht passen. Dabei heißt das Einlassen auf andere Wege nicht, die eigenen Denkkonzepte aufzugeben. Allein die Bereitschaft zum Austausch kann dazu führen, dass Lösungsräume wachsen. Mit der Bereitschaft sich auf unterschiedliche Weltsichten einzulassen und dabei neue Möglichkeiten zu erkennen, besteht das Anliegen des achtteiligen Essays darin, aufbauend auf klimatischen Veränderungsprozessen sowie gesellschaftlichen Betrachtungen zu zentralen Machtinteressen und dezentralen Lösungsräumen einen Beitrag für ein mögliches Zukunftsbild einer gedeihenden Gesellschaft und ihr Energiesystem zu liefern.
Das erste Kapitel unter dem Titel “Das Klima zwischen Panik und Gelassenheit” leitet dazu ein.
“Wir haben darauf zu vertrauen, dass jeder einzigartig ist und alle verschieden. Das muss zur vollen Blüte gebracht und in Kooperation mit anderen zusammengeführt werden, damit etwas entsteht, was höchste Flexibilität besitzt. Flexibilität ist das Rezept der Natur zur besten Anpassung von höher entwickelten Wesen an zukünftige Anforderungen. Sie sind nicht optimiert auf ganz bestimmte Situationen, sondern sie sind optimiert auf etwas, was prinzipiell unbekannt ist, eben auf eine Zukunft hin, die wesentlich offen ist.”,
Hans-Peter Dürr, Quantenphysiker, langjähriger Mitarbeiter von Werner Heisenberg, Träger des Alternativen Nobelpreises
Inhalt
- Das Klima zwischen Panik und Gelassenheit
- Risiken und Chancen gesellschaftlicher Veränderungen
- Das Energiesystem im Spannungsfeld von zentraler und dezentraler Gestaltung
- Das zellulare Konzept als Moderator unterschiedlicher Interessen
- Energiequellen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
- Digitalisierung im Energiesystem lokal oder mit Big Data
- Folgerungen für das Zukunftsbild zum Energiesystem
- Das Zukunftsbild einer lokal handelnden und global gedeihenden Gesellschaft
Das Klima zwischen Panik und Gelassenheit
Worte als Knüppel
Eine Flut neuer Begriffe überschwemmt die deutsche Sprache. Sie lauten Klimaleugner, Klimaskeptiker, Klimakrise oder auch Klimaterroristen. Das Standardwerk der deutschen Rechtschreibung kennt die meisten Begriffe nicht. Das Klima lässt sich weder leugnen, noch befindet es sich in der Krise. Es umfasst einfach den Durchschnitt dynamischer Prozesse in der Atmosphäre über lange Zeiträume auf Basis von Energie- und Wasserbilanzen. Wir werden noch sehen, bei welchen Veränderungen von Temperatur, Meeresspiegel und geologischen Formationen sich das Leben entfaltete. Die Menschheit wird nicht die Erde oder das anpassungsfähige Leben auslöschen. Eine versagende Menschheit kann aber die eigene Lebensgrundlage und damit die eigene Existenz auslöschen.
Es ist somit gerechtfertigt, auch Ängste zu haben. Menschen, die diese Angst außerhalb der Regeln kommunizieren, richten die Aufmerksamkeit auf Probleme. Aber ist deshalb der Begriff Klimaterrorist gerechtfertigt? Was zeichnet einen Klimaterroristen aus? Bedeutet das Unwort des Jahres 2022, das Klima als Terrorwaffe einzusetzen oder schadet der Terror dem Klima? Anderseits stellt sich die Frage, ob globale Probleme durch Verstärkung der Ängste oder eher durch Zusammenarbeit, Hoffnung und Motivation gelöst werden.
Aber lassen wir die Schlacht der Begriffe beiseite. Offensichtlich bekämpfen sich zwei Seiten in einer unversöhnlich geführten Debatte mit Schlagworten, um die andere Seite zu diskreditieren. Die von zunehmender Konfrontation geprägte Situation stellt so manche Gewissheit auf dem Prüfstand. Deshalb sollte die Bereitschaft vorhanden sein, bisheriges Wissen und Ideologien zu hinterfragen. Mit einer festgefügten Weltsicht betreibt man Framing. Wir ordnen Sachverhalte in das eigene Bedeutungsumfeld ein. Eine unsichtbare rosa Brille sorgt dafür, die Welt mit unseren Wertvorstellungen abzugleichen und andere mögliche Weltsichten auszufiltern. Verschiedene Weltsichten beim Blick auf die Welt zuzulassen, erweitert das Feld der Möglichkeiten.
Diese Methode mag ebenso eine gewisse Weltsicht sein. Doch gerade dies führte mit der Quantenphysik vor 100 Jahren zum Erfolg von Technologien und zu erweiterten Weltsichten.
Die Welt der Möglichkeiten
Physiker glauben an eine relative Welt, die durch parallele Möglichkeiten und Schwingungen geprägt ist. Dadurch befindet sie sich in ständiger Veränderung ohne starre Zusammenhänge. Laut Quantenphysik beeinflusst der Beobachter das Beobachtete mit seiner Intention. Deshalb schaffen wir alle die eigene, innere Welt. Diese Welten scheinen zunehmend aufeinander zu prallen. Wie wäre es, wenn Menschen mit einer Art Quantenphilosophie ihre Überzeugungen als eine Möglichkeit neben anderen Möglichkeiten reflektieren? Dies erfordert eine ständige Selbstbeobachtung, denn jeder Mensch unterliegt einem Framing. Die absolute Wahrheit gibt es in der Physik nicht. Wenn der Beobachter seine Intention in Frage stellt und den Fokus von seiner Weltsicht abwendet, bereit ist zur Veränderung, erscheinen Alternativen.
Das Verstehen verschiedener Sichten kann bei der Begegnung von Menschen hilfreich sein. Dieses Zugehen auf andere Menschen wird erschwert, wenn der Formulierung anderer Möglichkeiten Angriffe und Beleidigungen entgegengesetzt werden. So wird schnell der eigene gute Willen gestört und man unterliegt der Gefahr einer emotionalen Reaktion. Aber letztendlich müssen wir es alle schaffen, Aggressivität nicht zuzulassen, da ansonsten die Spaltung der Gesellschaft droht. Ein Perspektivwechsel von Zeit zu Zeit zwischen rosaroter und blauer Brille oder auch anderen Farben kann sehr hilfreich sein, die Welt zu befrieden und dabei gemeinsam, den Erfolg aller mehrend, zusammenzuarbeiten.
Differenzen, also Unterschiede, sind Ursache von Energie und damit Antriebskraft gesellschaftlicher Entwicklung. Der gerichtete Einsatz von Differenzen erfordert Kommunikation, also das Gespräch über vorhandene Differenzen. Letztendlich erzeugt die Bereitschaft zum kulturellen Austausch zwischen Gesellschaften gegenseitigen Nutzen. Der in der aktuellen Diskussion negativ besetzte Begriff der kulturellen Aneignung kann somit als Chance zur Erweiterung der Weltsicht und zur gemeinsamen Entwicklung betrachtet werden. Ohne Differenzen würde die menschliche Gesellschaft erstarren. Aus Sicht der Physik ist es sinnvoll, Differenzen zu betonen und gleichzeitig Verbundenheit zu schaffen, anstatt Differenzen durch eine weltweite gesellschaftliche und kulturelle Einheit mit einseitigem, moralischem Führungsanspruch auszugleichen.
Das Klima im Wandel der Zeiten
Ausgeprägte Weltsichten führen dazu, dass einerseits die Klimaveränderung mit der Zerstörung der Erde und ihrer Lebensgrundlagen gleichgesetzt wird. Gegensätzliche Extrempositionen bezweifeln andererseits den Klimawandel vollständig und stellen somit auch alle Maßnahmen gegen den Wandel in Frage.
Mit einem gewissen Fatalismus lässt sich auch der Standpunkt einnehmen, dass es am Schluss keine Rolle spielt, in welchem Ausmaß die Veränderungen des Klimas ausfallen und wodurch sie verursacht werden. War es nicht auch immer das Schicksal der Menschheit, umfangreiche Anpassungsfähigkeit beweisen zu müssen. Unter diesem Blickwinkel lautet die Frage, welchen Grad der Klimaveränderung und welche Geschwindigkeit der Klimafolgenanpassung die Menschheit bewältigen kann. Ungeachtet dessen wäre trotzdem darüber nachzudenken, wie lange der aktuelle Umfang der Nutzung der Erdressourcen unabhängig vom Grad des Klimawandels möglich ist. Wir wollen dazu nicht urteilen, denn es geht hier nicht darum, Position zu beziehen. Stattdessen soll der Blick in den Kapiteln des Essays auf verschiedene Möglichkeiten gelenkt werden, um die Lösungssuche zu erweitern, statt einzuengen.
Der Klimawandel zerstört nicht die Erde. In den letzten 500 Millionen Jahren der Erdgeschichte konnten die Veränderungen auch nicht das äußerst anpassungsfähige, biologische Leben auf dem Planeten auslöschen. Aber ein zu schnell stattfindender Klimawandel kann die Lebensgrundlagen der modernen Gesellschaft zerstören. Die Aufgabe besteht also darin, die Fähigkeit der Menschheit zur Klimafolgenanpassung zu beurteilen. Diese Folgenabschätzungen werden für verschiedene Szenarien zur Klimaveränderung benötigt. Darauf basierend sind wiederum Initiativen und Maßnahmen abzuleiten, um die Empfindlichkeit natürlicher und menschlicher Systeme gegenüber tatsächlichen oder erwarteten Auswirkungen der Klimaänderung zu verringern. Die Erdgeschichte zeigt uns mögliche Extremszenarien von Veränderungsprozessen. Der Blick in die Vergangenheit lohnt sich.
Erdgeschichte und Klima
Jahrmilliarden der Bakterienherrschaft
Von vier Milliarden erdgeschichtlicher Entwicklung können wir an dieser Stelle 3,5 Milliarden Jahre ausblenden, da die damalige Atmosphäre aus Wasser und Kohlendioxid höheres Leben in der uns bekannten Form unmöglich machte. Nur Bakterien leben schon seit frühester Erdgeschichte auf dem Planeten. Kohlendioxid in der Luft löste sich zum größten Teil bis vor 2,5 Milliarden Jahren in den Meeren. Dies initiierte wiederum vor rund 2,4 Milliarden Jahren die “Kryosphäre-Eiszeit”. Während dieser Zeit war die Erde von einer dicken Eisschicht bedeckt, die sich von den Polen bis zu den Tropen erstreckte. Der Grund war die starke Abkühlung der Oberflächentemperatur aufgrund des sinkenden Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Erst mächtige, großflächige Vulkanausbrüche, die Jahrtausende anhielten, konnten den Schneeball Erde aus dem Kälteschlaf befreien.
Die weitere Reduktion von Kohlendioxid startete vor über 2 Milliarden Jahren durch das Einsetzen der Photosynthese zur Energieerzeugung bei bestimmten Bakterienarten. Sie nutzten das Kohlendioxid und produzierten Sauerstoff. Bald bildeten sie auch die ersten mehrzelligen Lebewesen in den Meeren vor 600 Millionen Jahren. Zunächst reagierte dieser Sauerstoff aber vorrangig mit Mineralien auf der Erdoberfläche oder im Meer. Die Mineralien rosteten und es verblieb noch kein relevanter Überschuss für die Atmosphäre. Erst vor 500 Millionen Jahren verblieb genug Sauerstoffüberschuss, um den Wandel zu einer Atmosphäre mit hohem Sauerstoffanteil einzuleiten. Dazu trugen besonders die zu dieser Zeit auftretenden ersten Landpflanzen bei. Die uns bekannte Atmosphäre mit einem Sauerstoffanteil von 23 und 30 Prozent bildete sich heraus. Die Entwicklung der Vielfalt des biologischen Lebens konnten sich entwickeln.
Eine halbe Milliarde Jahre des mehrzelligen Lebens
Die folgenden 500 Millionen Jahre Erdgeschichte und das Gedeihen biologischen Lebens waren von heftigen Klimaschwankungen geprägt. Das Ausmaß wird am besten am heutigen Zustand vergleichbar. Im Jahr 1990 betrug die globale Durchschnittstemperatur über alle Weltregionen und Jahreszeiten 14 Grad Celsius. In den letzten 500 Millionen Jahren war die Erde zu rund 75 Prozent der Zeit mit Temperaturen zwischen 20 bis 25 Grad Celsius deutlich wärmer. Besonders interessant waren diese Zeiträume für die Ausprägung der Vielfalt des biologischen Lebens. Beginnend vor 250 Millionen Jahren bis vor 65 Millionen Jahren explodierte der Artenreichtum im tropischen Klima auf dem gesamten Planeten bei globalen Durchschnittstemperaturen bis zu 25 Grad Celsius.
In diesen 500 Millionen Jahren gab es aber auch drei sehr kalte Perioden, in denen die Pole der Erde sowie größere Landmassen vereisten. In der letzten dieser Kaltzeiten leben wir. Jede Periode hielt mehrere zehn Millionen Jahre an. Dies betrifft zwei Eiszeitphasen vor 450 und vor 300 Millionen Jahren. Vor 35 Millionen Jahren kam es wiederum zur Abkühlung. Dies löste die dritte Eiszeitphase aus. Ausgelöst wurde die letzte Phase wahrscheinlich durch die Kontinentaldrift und die damit verbundene Veränderung der Meeresströmungen um die Antarktis. Mit jeder Eiszeitphase wurde ein neuer Kälterekord erreicht.
In der aktuellen Phase wechselt das Klima zwischen Kaltzeiten und Zwischeneiszeiten. Dabei bedeckt das Eis in den Kaltzeiten große Teile der Kontinente. In den wärmeren Abschnitten zieht sich das Eis auf die Pole zurück, so dass vorrangig Grönland und die Antarktis von Eisgletschern bedeckt sind. Als Kaltzeit mit einer minimalen globalen Durchschnittstemperatur von acht Grad Celsius erreichte die Weichsel-Eiszeit vor 25.000 Jahren einen Negativrekord. Sie endete vor 20.000 Jahren mit einer über 12.000 Jahre anhaltenden Erwärmungsphase bis auf das heutige Niveau der globalen Durchschnittstemperatur.
Fortschritte der menschlichen Zivilisation nach dem Ende der letzten Kaltzeit
Die Erwärmungsphase nach der letzten Kaltzeit sowie das weitgehend konstante Klima über sieben Jahrtausende mit nur zwei Grad Schwankungsbreite und einem relativ unveränderlichen Meeresspiegel legte die Grundlage zur erfolgreichen Menschheitsentwicklung. Auf der anderen Seite bewies die Menschheit mit der Entwicklung des Homo Sapiens über 300.000 Jahre während mehrerer Phasen von Kalt- und Zwischeneiszeiten bei Temperaturschwankungen um zehn Grad und Veränderungen des Meeresspiegels um 120 Meter eine hohe Anpassungsfähigkeit. Im Wettbewerb der Arten erwies sich der Homo Sapiens dem Neandertaler überlegen, der während der letzten Kaltzeit vor ungefähr 40.000 Jahren ausstarb.
Natürlich sind direkte Vergleiche unzulässig. Die moderne Gesellschaft reagiert aufgrund der hohen Anzahl der Menschen, der modernen Technologieanforderungen und des Vernetzungsgrades bedeutend anfälliger auf Veränderungen der Umweltbedingungen. Besonders ist die Menschheit von Veränderungen des Meeresspiegels betroffen. Ballungsgebiete der menschlichen Zivilisation, kritische Infrastrukturen und Industriezentren befinden sich zu einem hohen Anteil in Meeresnähe. Deshalb schauen wir uns den Meeresspiegel im Hinblick auf den Klimawandel über 500 Millionen Erdgeschichte noch etwas genauer an.
Klimawandel und Meeresspiegel
Seit 10.000 Jahren lebt die Menschheit nun im sogenannten Holozän, einer Zwischeneiszeit mit globalen Durchschnittstemperaturen zwischen 14 und 16 Grad Celsius. Wir befinden uns am Temperaturhöhepunkt der Zwischeneiszeit, denn Warm- und Kaltzeiten wechseln wie eine Sägezahnkurve. Einer rund 90.000 Jahren währenden Abkühlung bis zum Maximum der Kaltzeit folgt eine über 10.000 Jahre reichende, relativ schnelle Erwärmung bis zum Temperaturmaximum der Warmzeit. Aus geologischer Sicht steht die Menschheit wieder vor einer Abkühlungsphase über die nächsten 90.000 Jahre.
Doch jetzt ergänzt die Menschheit natürliche Faktoren durch eigenes Handeln. Wir müssen also an diesem Punkt genauer hinschauen, um die Auswirkungen einer Klimaveränderung mit früheren Zeiten zu vergleichen. Was sind die grundlegenden Folgen des Wandels?
Der Begriff Klima beschreibt die Energie- und Wasserbilanz der Erde und das daraus resultierende durchschnittliche Verhalten der Atmosphäre. Mit der Wasserbilanz ist der Stand des Meeresspiegels verbunden. Klimafolgenuntersuchungen benötigen Ergebnisse aus der Forschung zur Veränderung des Meeresspiegels in der Erdgeschichte aufgrund verschiedener Klimaperioden. Da sich höheres Leben auf den Kontinenten erst durch Sauerstoff in der Atmosphäre entwickelen konnte, ist die Rückschau über 500 Millionen Jahre ausreichend. Nützlich sind hierfür drei verschiedene Zeitmaßstäbe.
Der Wandel in Hunderten von Jahrmillionen
Die letzten 500 Millionen Jahre der Erdgeschichte umfassen drei Kaltphasen der Vereisung der Pole und großer Landmassen sowie drei Warmphasen mit Eisfreiheit. Während dieses Zeitraumes schwankte die mittlere, globale Temperatur zwischen rund 10 und 26 Grad Celsius. [Scotese, 2016]
Zur Abschätzung der daraus folgenden Veränderungen des Meeresspiegels forschen Wissenschaftler an verschiedenen Ablagerungsschichten aus unterschiedlichen Zeitaltern in allen Teilen der Welt. Damit können aber nur langfristige Meeresspiegelschwankungen in Zeiträumen von einigen Dutzend Jahrmillionen beschrieben werden. Die Ergebnisse weisen auf Unterschiede des Meeresspiegels zwischen 200 und 350 Meter hin, wobei die mittlere Geschwindigkeit der Veränderungen bei vier Zentimetern pro 10.000 Jahre liegt. Diese langfristigen Zyklen ließen dem Leben ausreichende Zeit zur Anpassung an veränderte Bedingungen.
Klima und Meeresspiegel nach Aussterben der Saurier
Plattenbewegungen des vor 200 Millionen Jahren zerbrochenen Urkontinents Pangäa führten die Antarktis zum Südpol. Mit der Vergrößerung des Abstandes der Antarktis zu Südamerika und Australien bildete sich vor 50 Millionen Jahren eine kalte Meeresströmung um die Antarktis. Der Polarwirbel formte die Antarktis zum Kühlschrank der Erde. Er sorgte dafür, dass die globale Durchschnittstemperatur bis auf 15 Grad Celsius vor 35 Millionen Jahren sank. Ab diesem Zeitpunkt begann der Kontinent einzufrieren und die dritte Eiszeitphase der letzten 500 Millionen Jahre war eingeläutet. Die aufgrund der Plattenbewegungen vor drei Millionen Jahren stattfindende Vereinigung von Nord- und Südamerika im Bereich von Panama bewirkte die weitere Beschleunigung der Abkühlung, da sich die Meeresströmungen radikal änderten.
Den Meeresspiegel zu Beginn der Abkühlungsphase schätzen Wissenschaftler auf ungefähr 80 Meter über dem heutigen Niveau. Der Polarwirbel um die Antarktis und die Verbindung Amerikas sorgen dann dafür, dass der Meeresspiegel bis vor einer Million Jahre auf 40 Meter unter dem heutigen Niveau sank. Die Veränderungsgeschwindigkeit betrug bei einer nicht korrekten, linearen Betrachtung rund 2,5 Zentimeter pro 10.000 Jahre.
Die Entwicklung verschiedener menschlicher Arten startete vor ungefähr drei Millionen Jahren. Die Wiege der Menschheit steht in Afrika und vor einer Million Jahre boten dort die Höhenlagen und das warme Klima genügend Zeit für Fortschritte. Doch danach werden Klimaveränderungen für den sich in der Evolution vor 300.000 Jahren durchsetzenden Homo Sapiens interessant. Die erfolgreichste Art der Menschen zog aus Afrika aus, um den gesamten Globus zu besiedeln.
Das Klima während der Entwicklung des modernen Menschen
Der Siegeszug der heutigen Menschenart, dem Homo Sapiens, begann ausgerechnet in einer Eiszeit. Während die Saurier in einer tropischen Umgebung auf allen Kontinenten mit einem Überfluss an Pflanzen und Tieren lebten, mussten sich die Menschen ihren Lebensraum bei unterschiedlichsten und auch harscheren Bedingungen erkämpfen. Die intellektuellen Leistungen der Menschen waren somit mehr gefordert als bei den Sauriern. Dies gibt Hoffnung für die weitere Fähigkeit der Menschheit zur Anpassung an Klimaveränderungen, wenn diese nicht zu radikal eintreten.
Was bedeuten also radikale Klimaveränderungen? Dazu lohnt der Blick auf die Temperaturen und den Meeresspiegel während der letzten drei Millionen Jahre. Die mit der Verbindung von Nord- und Südamerika verstärkte Abkühlung löste eine seitdem anhaltende Phase heftiger Temperaturschwankungen in Rhythmen von 100.000 und von 40.000 Jahren aus. Die globalen Durchschnittstemperaturen veränderten sich dabei bezogen auf den Wert von 1990 um bis zu 2 Grad nach oben in den Zwischeneiszeiten und bis zu 8 Grad nach unten in den Kaltzeiten. Bei einer Durchschnittstemperatur von 14 Grad Celsius im Jahr 1990 schwanken die globalen Temperaturen somit seit drei Millionen Jahren zwischen 6 und 16 Grad.
Die letzte Eiszeit, bekannt auch als Weichsel-Eiszeit, war dabei die kälteste Periode seit drei Millionen Jahren. Der Meeresspiegel lag 120 Meter tiefer als heute. Diese Kaltzeit endete vor 20.000 Jahren. Die folgende Zwischeneiszeit erreichte ihre Höchsttemperatur vor 7.000 Jahren bei einem Meeresspiegel ungefähr auf heutigem Niveau. Die größte Veränderung des Meeresspiegels um 120 Meter fand beginnend vor 20.000 bis vor 7.000 Jahren statt. Somit betrug die Veränderungsgeschwindigkeit rund 90 Meter in 10.000 Jahren anstatt 2,5 cm in 10,000 Jahren wie zur tropischen, globalen Warmzeit zur Zeit der Saurier. Die umfassendste Veränderung des Meeresspiegels findet in Eiszeitphasen der Erdgeschichte durch Entstehung und Abschmelzen des Eises auf Landmassen statt.
In den letzten sieben Jahrtausenden schwankte die globale Durchschnittstemperatur nur noch um ungefähr zwei Grad und der Meeresspiegel stieg um weitere fünf Meter auf den aktuellen Stand.
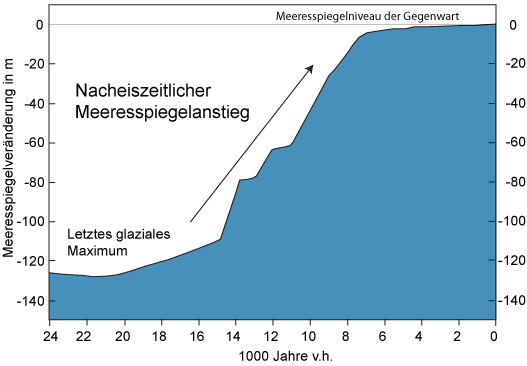
Bildquelle: Dieter Kasang — Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-SA 3.0 DE)
Klimawandel und menschliche Zivilisation
Das Klima während menschlicher Fortschritte
Die frühe Entwicklung der Menschheit über 300.000 Jahre bis vor 10.000 Jahren war von der Wanderschaft über den gesamten Globus und die dabei bewiesene Anpassungsfähigkeit gekennzeichnet. Katastrophale Veränderungen in Küstennähe durch den Anstieg des Meeresspiegels vor 10.000 bis vor 7.000 Jahren trafen aber die erste sesshafte Zivilisation zwischen Euphrat und Tigris besonders. Der Meeresspiegel lag zu dieser Zeit noch 40 Meter unter dem heutigen Stand. Dies inspirierte eventuell auch die Geschichte um die Vertreibung aus dem fruchtbaren Paradies des Gartens Eden. Der starke Anstieg des Meeresspiegels erscheint weiterhin in Legenden zur Sintflut auf allen Kontinenten. Hierunter lässt sich auch der Durchbruch des Mittelmeers vor 8.000 Jahren in das um 100 Meter tieferliegende schwarze Meer einordnen.
Aber in den letzten 7.000 Jahren hat die Menschheit das Glück, bei einem relativ konstanten, globalen Temperaturniveau zu leben. Der Meeresspiegel veränderte sich nur noch um rund zwei bis fünf Meter, also ungefähr fünf Zentimeter pro Jahrhundert. Die damit verbundene Berechenbarkeit der Umweltbedingungen auf Grundlage langfristiger Beobachtungen ermöglichte die menschliche Zivilisation. Sesshaftigkeit, Ackerbau und Viehzucht sowie Städtebau bildeten vor 7.000 Jahren die Erfolgsgrundlage zur Entwicklung der modernen menschlichen Gesellschaft.
Zwischen Anpassungsfähigkeit und Begrenzung des Wandels
Wir finden also die heftigsten Temperatur- und Meeresspiegelschwankungen seit drei Millionen Jahren unter den Bedingungen der Eiszeit. Die starken Veränderungen des Meeresspiegels zu Beginn und Ende von Eiszeiten forderten der Menschheit hinsichtlich Anpassungsfähigkeit und Ausprägung intellektueller Leistungen viel ab. Aber die umfassende Entwicklung der komplexen, menschlichen Gesellschaft war erst in einer Phase relativer Ruhe vor Klimaveränderungen möglich.
Es stellt sich nun einerseits die Frage, welche Klimaveränderungen und damit verbundene Veränderungen des Meeresspiegels, der Klimazonen und des Wetters in den verschiedenen Regionen der Erde durch Klimafolgenanpassungen ausgeglichen werden können. Anderseits muss die Menschheit auch die Frage beantworten, welcher Grad an Veränderungen die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft überstrapaziert. Letztendlich liegt darin die Wurzel der Heftigkeit der Auseinandersetzung zwischen Klimapanik und Gelassenheit gegenüber dem Wandel.
Die Frage nach dem Verhältnis von Maßnahmen zur Eingrenzung der Veränderungen des Erdklimas sowie von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen von Klimaveränderungen kennt keine einzig richtige Antwort. Die menschliche Gesellschaft ist von äußerster Komplexität gekennzeichnet. Die Reaktion auf Klimaveränderung erfordert deshalb auch einen Blick auf die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung.
Quellen
[Scotese, 2016] Scotese, Christopher. A NEW GLOBAL TEMPERATURE CURVE FOR THE PHANEROZOIC, Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 48, No. 7, 2106. doi: 10.1130/abs/2016AM-287167
“Zukunftsbild einer gedeihenden Gesellschaft” — Leimen / Heidelberg — 16. Februar 2023
Andreas Kießling, energy design