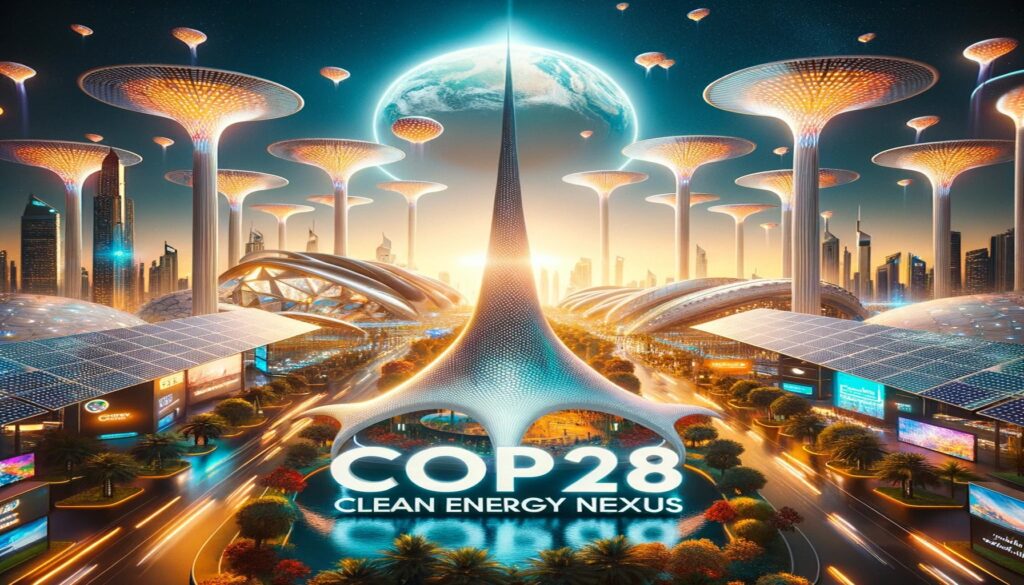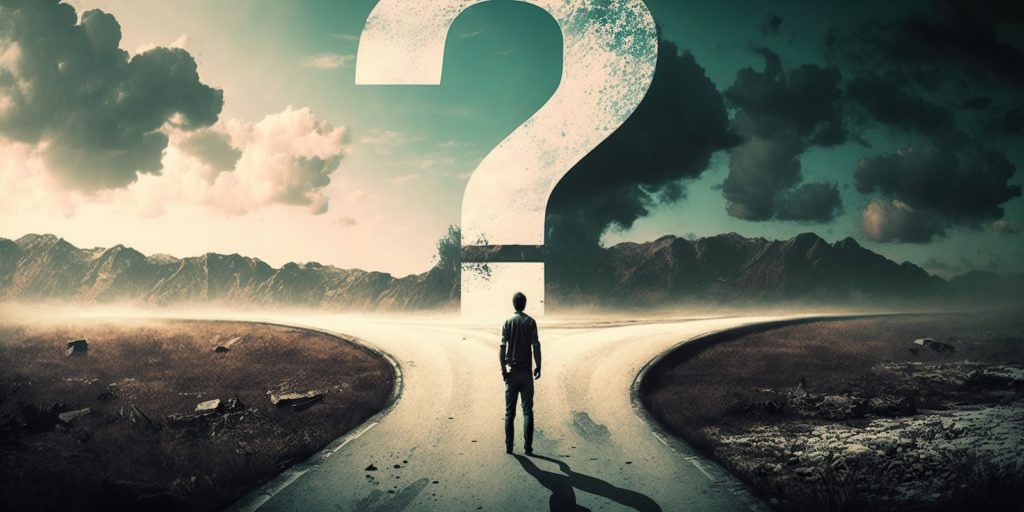Chancen zum Gedeihen durch Inspiration und Innovation
“Menschen leiden, Menschen sterben, unsere Ökosysteme brechen zusammen, wir stehen am Anfang eines Massensterbens”, sagte Klimaaktivistin Greta Thunberg auf dem Klimagipfel in New York. “Und alles, worüber ihr sprechen könnt, ist Geld.”
Greta Thunberg kritisiert zu Recht in sehr emotionaler Weise das hohe Maß an Unverantwortlichkeit beim wirtschaftlichen Handeln auf unserem Planeten. Der Klimawandel bedroht nicht die Erde und auch nicht unbedingt das nackte Überleben eines Teils der Menschheit. Aber der Wandel gefährdet mit Sicherheit die Errungenschaften unseres gesellschaftlichen Zusammenwirkens. Es droht der Kollaps der modernen Industriegesellschaft und damit ein Rückfall in dunkle Zeiten der Zivilisation.
Angesichts dieser Gefahren immer wieder die Priorität heutigen Wirtschaftskreisläufen und der Steigerung des Geldvermögens zu geben, ist nicht nur unverantwortlich. Dieses Verhalten ist egoistisch und stellt eine völlige Mißachtung der Interessen nachfolgender Generationen dar.
Politik spricht von Kompromissen und der Erhaltung von Arbeitsplätzen, wobei sie gleichzeitig den Verlust von Arbeitsplätzen in Zukunftsbranchen tatenlos zur Kenntnis nimmt. Aber wenn mit Minimalhandlungen nicht das Notwendige getan wird, versagt die Elite dieser Gesellschaft.
Diesen Betrachtungen soll nun ein weiterer Gedanke hinzugefügt werden. Eine psychologische Tatsache ist es, dass Menschen vor starken Veränderungen Angst verspüren. Vorrangig möchten sie, dass bekannte Lebensumstände erhalten bleiben und kein Verlust entsteht. Sie glauben nicht so leicht den Versprechungen neuer Möglichkeiten. Die Akzeptanz für Veränderungsprozesse benötigt damit einen intensiven Prozess der Einbeziehung aller Menschen in die Diskussion neuer Wege und Chancen. Diese Chancen ergeben sich dabei oft aus der Fokussierung auf persönliche, lokale und regionale Lebensumstände. Hier sind Möglichkeiten oft leichter verständlich zu machen. Wir suchen die Chancen zum Wachstum oder besser ausgedrückt zum Gedeihen durch Inspiration und Innovation.
Beteiligung an lokaler und regionaler Gestaltung von Nachhaltigkeit
Es ist also notwendig, in Beteiligungsprozessen zu erarbeiten und begreifbar zu machen, wie aus Problemen neue Chancen erwachsen. Die grundlegende Erkenntnis zur Ergreifung dieser Möglichkeiten ist aus Studien bekannt. Die jeweiligen Potentiale sind aber aufgrund lokaler, regionaler Umfelder zu untersuchen und in Standortkonzepte nachhaltiger Entwicklung und Energieangebote zu überführen. Dazu gilt es, sich mit dem Begriff des nachhaltigen Wachstums auseinander zu setzen.
Im Kern wird mit dem Begriff Nachhaltigkeit das Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung beschrieben. Dabei soll eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung durch die Bewahrung der natürlichen Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme (insbesondere Lebewesen und Ökosysteme) gewährleistet werden. [Seite „Nachhaltigkeit“, In: Wikipedia, 06.10.2019]. Die Definition deutet darauf hin, dass hiermit eher Dynamik als Statik beschrieben wird. Die Entwicklung der Lebensräume und damit der darin eingebetteten Energiesysteme ist ein dynamischer Prozess der Veränderung, der die Systemwandlung beinhaltet.
Der Erhalt des Lebens erfordert aber auch eine gewisse Stabilität des Systems und seiner wesentlichen Eigenschaften. Zur Entwicklung des Lebens werden die Systemressourcen der jeweiligen Lebensräume benötigt. Um die notwendige Stabilität des Systems zu sichern, ist zwingend dessen Regenerationsfähigkeit zu gewährleisten. Diese ergibt sich auf Grundlage interner Prozessgeschwindigkeiten und auf Basis des Austausches mit der externen Systemumgebung durch Zuflüsse und Abflüsse. Dieses fragile, metastabile Gleichgewicht wurde durch die übermäßige Nutzung unserer fossilen Ressourcen sowie der natürlichen Angebote unserer Lebensräume gestört.
In diesem komplexen Umfeld bewegt sich der Kern der Nachhaltigkeitsdiskussionen und die Suche nach dem Gedeihen durch Inspiration und Innovation.
Bedeutet Nachhaltigkeit Verzicht?
Was ist daraus für das zukünftige Handeln der Menschen im jeweiligen Lebensumfeld zu schließen?
Keanu Reeves kündigte im Film „Der Tag, an dem die Erde stillstand“ das Ende der Entwicklung mit den Worten an: „Ihr werdet für eure Art zu leben einen hohen Preis zahlen“. Er erhielt die Antwort: „Aber wir können uns ändern und eine gerechte Welt aufbauen. Kurz vor dem Abgrund entwickeln wir uns weiter.“ Wie sollte diese Veränderung aber aussehen?
In Deutschland werden die meisten Menschen der Erkenntnis zustimmen, dass wir unsere Lebensweise verändern müssen, um dem Klimawandel zu begegnen. Über den Weg besteht aber keine Einigkeit. Auf der einen Seite stehen Vorschläge für mehr Verzicht, für Verbote und den Übergang in ein wachstumsloses Wirtschaftssystem. Dem stehen Entwürfe für ein nachhaltiges Wachstum gegenüber. Sie vertrauen den Fähigkeiten der Menschheit, um Gedeihen durch Inspiration und Innovation zu gestalten.
Die Verzichtsdiskussion basiert auf der Erkenntnis, dass die Menschheit in den letzten zwei Jahrhunderten dem Ökosystem der Erde geschadet hat. Wir verbrauchen die über Jahrmillionen entstandenen Ressourcen wie Kohle, Öl und Gas innerhalb weniger Jahrhunderte. Noch deutlicher wird das menschliche Handeln angesichts der folgenden Tatsache. Selbst die innerhalb eines Jahres nachwachsenden Ressourcen werden inzwischen innerhalb von sieben Monaten eines Jahres verbraucht. Bald benötigt die Menschheit zwei Erden für ihren unstillbar wachsenden Bedarf. Wir betätigen uns auf dem Planeten Erde quasi als „Schädling“. Damit geht es um unseren Willen, weniger schädlich zu sein.
Bei näherer Betrachtung nutzen die führenden Industrieländer sowie wachsende Nationen wie China den größten Teil der Ressourcen. Eine Verzichtsdiskussion würde einerseits fordern, dass die führenden Industrieländer die weitere Entwicklung begrenzen. Auf der anderen Seite verbietet aber ein derartiger Ansatz in seiner Konsequenz dem größten Teil der Menschheit in weniger entwickelten Regionen, ihren gerechten Anteil am Wohlstand einer Minderheit einzuforden.
Gestaltung neuer nachhaltiger Handlungsräume mit Innovation und Inspiration
Soll Ungerechtigkeit nicht zementiert und das Wachstum der gesamten Menschheit ermöglicht werden, bleibt nur der Weg des nachhaltigen Wachstums.
Professor Leukefeld plädiert hierzu für einen neuen Ansatz: „Es geht nicht mehr um weniger schädlich, sondern um nützlich, was letztlich eine neue industrielle Revolution bedeutet, weil es sämtliche Herstellungsprozesse in sinnvollster Weise auf den Prüfstand stellt. Dabei geht es darum, alles Verbrauchte zurück in den Ressourcenkreislauf zu geben. Dies bewirkt den Wandel vom schädlichen Wirken zum nützlichen Handeln.“
Dabei lohnt es sich, das Zusammenspiel aller Lebensformen im Ökosystem anzuschauen. Das Gedeihen und Vergehen von Leben basiert auf geschlossenen Stoffkreisläufen. Planzen gedeihen in einem Umfang, wie es die Bedingungen der Umgebung erlauben. In einem dynamischen Prozess dehnen sie sich aus und ziehen sich entsprechend den Umweltbedingungen zurück. Das Gedeihen basiert auf dem Gleichgewicht zwischen zufließendem Angebot und Nutzung von Ressourcen.
Entsprechend kann die menschliche Gesellschaft langfristig nur bei Erhaltung dieses Gleichgewichtes gedeihen. Eventuell sollten wir den Begriff der Nachhaltigkeit durch den Begriff Gedeihen ersetzen. Dies beschreibt eher, worum es den Menschen bei der Entwicklung der Zivilisation geht. Allen Lebensformen ist das Bestreben zum gedeihlichen Wachstum immanent. Gleichzeitig legt ein Wachstum, das die Grenzen der möglichen Zuflüsse an Ressourcen überschreitet, die Grundlage für den Untergang von Lebensformen.
Insofern gibt es zwei Möglichkeiten, die Überschreitung der Ressourcengrenzen zu beenden.
Die erste Lösung besteht im Verzicht. Angesichts der in vielen Teilen der Welt herrschenden Armut ist dieser Weg zynisch. Alle Regionen der Welt haben das Recht, ihren Anteil am Wohlstand einzufordern.
Der zweite Weg folgt dem Gedeihen durch Inspiration und Innovation, um Wachstum bei geringerem oder effektiverem Ressourceneinsatz zu ermöglichen, aber auch beispielweise durch Raumfahrt die Möglichkeiten zum Überschreiten aktueller Ressourcengrenzen zu suchen. Es stellt sich die Frage, wie ein nachhaltiges Wachstum erreicht werden kann.
Geschäftsmodelle für den Wandel zum nachhaltigen Wachstum
Das neue Zentrum für Klimaschutz der Boston Consulting Group stellt fest, dass schnelle Fortschritte bei kohlenstoffarmen Technologien einen klaren Geschäftsvorteil für ehrgeizige Anstrengungen zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes schaffen. Geschäftsmodelle bei der Gestaltung eines nachhaltigen Wachstums haben längst ihre Wirtschaftlichkeit bewiesen (Beispiel Solarhäuser Cottbus).
“Die gute Nachricht ist, dass dramatische Emissionsreduzierungen nicht nur möglich sind, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind.”, sagte Michel Frédeau, Global Leader for Climate & Environment bei BCG und Co-Autor einer Publikation zu Geschäftsmodellen im Rahmen des Klimaschutzes.
Laut BCG-Forschung können die meisten Länder bereits rund 80% ihrer Pariser 2°C‑Beiträge erfüllen, ohne auf neue oder unerprobte Technologien zurückzugreifen. Infolgedessen dürften die wirtschaftlichen Auswirkungen aggressiver CO2-Reduktionen für viele einzelne Länder entweder positiv oder nur leicht negativ sein (rund ±1% des nationalen BIP im Jahr 2050).
An dieser Stelle kann keine erschöpfende Betrachtung zu den wirtschaftlichen Chancen geführt werden. Aber auf entsprechende Beispiele soll abschließend verwiesen werden.
Die Fortschritte bei Technologien zum Design auf molekularer Ebene erlauben den Einsatz völlig neuer Ausgangsmaterialien sowie die weitgehend abfallfreie Produktion. Dazu gehören insbesondere Methoden der Nanobiotechnologie sowie des 3D-Drucks. Diese Methoden verbessern auch die Umweltverträglichkeit beispielsweise der Produktion von Batterien und der Materialien für Solarenergiemodule. Gleichzeitig ist die Nutzung erneuerbarer Energien längst der Wirtschaftlichkeit von Kohle- und Kernkraftwerken überlegen.
Erneuerbare Energien sowie der Einsatz neuer Technologien und Materialien zur Meerwasserentsalzung können umweltverträglich der Wasserknappheit in vielen Regionen begegnen.
Neue Verfahren zum Anbau von Lebensmitteln in mehrgeschossigen Gebäuden durch Hydrokulturen begegnen der Nahrungsknappheit und der Überwirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen. Der hierfür benötigte hohe Energiebedarf ist wiederum durch Erneuerbare Energien zu decken.
Der Übergang vom öl- und gasgetriebenen Transportsystem zur Wasserstoffinfrastruktur für Flüge, Schifffahrt und Schwertransporte ermöglicht ein quasi unbegrenztes Angebot von Rohstoffen im Verkehrssektor. Voraussetzung hierfür ist natürlich ebenso der Einsatz erneuerbarer Energien zur Gewinnung von Wasserstoff.
Prinzip Hoffnung
Die genannten Beispiele sind sicherlich nicht erschöpfend. Aber sie zeigen die Möglichkeiten zum Gedeihen durch Inspiration und Innovation. Auch der aktuell stattfindende, erneute Aufbruch der Menschheit in das Weltall dehnt die Grenzen des Gedeihens aus.
Ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist möglich und heute schon an vielen Stellen wirtschaftlich. Es erfordert aber das Vertrauen in Inspiration und Innovation.
Das Beharren auf bekannten Lösungen und Funktionsweisen der Gesellschaft wird uns schnell die Grenzen des Wachstums aufzeigen. Dann würden die externen Zwänge den Verzicht erzwingen, ohne dass uns Optionen bleiben.
Die weitere Entwicklung der Menschheit kann nur auf dem Gedeihen durch Inspiration und Innovation beruhen. Dazu sind die Chancen derartiger Veränderungen durch Fokussierung auf regionale Möglichkeiten und damit zu Beteiligung und persönlichem Nutzen zu befördern. Auf diesem Wege wird den Menschen auch die Angst vor Veränderungen genommen.
Nur so lässt sich unser Versagen gegenüber den nachfolgenden Generationen verhindern.
Andreas Kießling, Leimen, 06. Oktober 2019