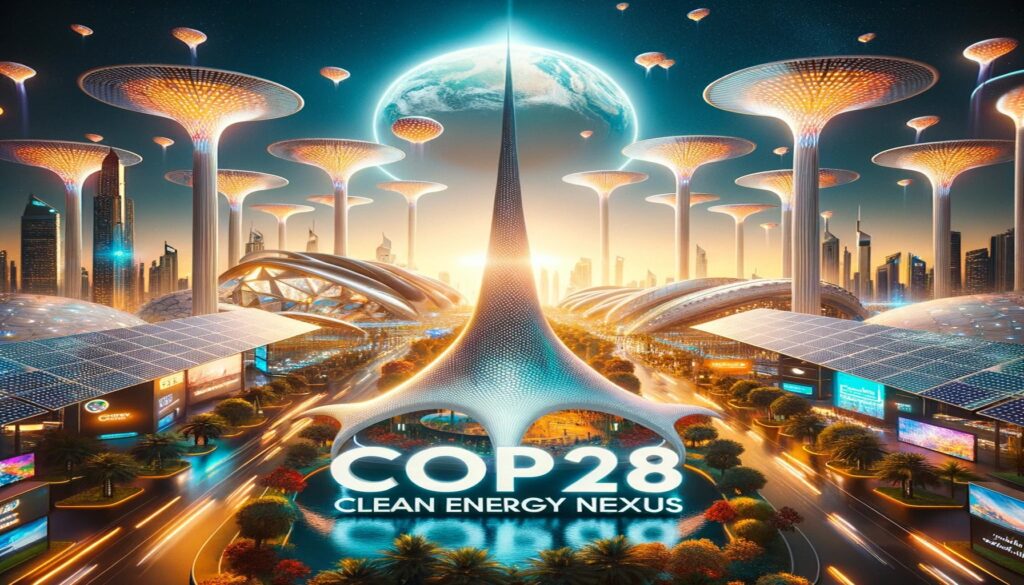Stand der Diskussion und Unvollständigkeit der Bewertung
Selten werden Begriffe so interessengebunden eingesetzt wie beim Thema “Solidarität im Energiesystem”. Unter dem Label Solidarität sollte eine bessere Welt geschaffen werden, aber der Versuch mißlang bekannterweise in Osteuropa. Es herrscht sicherlich weitgehend Einigkeit darüber, dass dieser Umstand Solidarität nicht als wünschenswerte Eigenschaft von Menschen und Gesellschaft verschwinden lässt.
Das Problem liegt aber im Einsatz dieses Begriffes nach Bedarf für oder gegen eine Angelegenheit. Beispielsweise wird gesellschaftlich weitgehend im Konsens ein Rentensystem nicht als unsolidarisch betrachtet, in das nur ein Teil der Gesellschaft einzahlt, aber ein anderer Teil attraktivere Altersvorsorge betreibt. Eigeninitiative im Stromsystem wiederum unterliegt dem Verdacht des unsolidarischen Handelns. Zwar besteht der Unterschied darin, dass aus dem gesetzlichen Rentensystem der in anderer Form vorsorgende Teil der Gesellschaft keine Leistungen bezieht. Aber in beiden Fällen wird die jeweilige Infrastruktur für einen Teil der Gesellschaft teurer als für alternativ agierende Akteure.
Diese Zweischneidigkeit der Anwendung von Begriffen kann unter dem Titel “Solidarität im Energiesystem” in verschiedenen Handlungsdomänen festgestellt werden. Während ansonsten die Macht des Marktes beschworen wird, lässt sich vermuten, dass der Begriff der Solidarität teilweise benutzt wird, um Handlungsräume in einem dezentralen Energiesystem einzuschränken. Hierzu soll nachfolgend ein Hinweis des Forums Netztechnik/Netzbetrieb (FNN) zitiert werden.
„Solidarität garantiert Sicherheit zu geringen Kosten und ist unverzichtbar. In elektrischen Verbundsystemen beruht der sichere Betrieb wesentlich auf der Solidarität der Netze und der darüber zusammengeschalteten Erzeugungsanlagen. Die Netzbetreiber stimmen sich ab, wie sich die Netze bei Störungen verhalten und sich gegenseitig unterstützen. Dies betrifft sowohl die regeltechnischen Fähigkeiten als auch die Leistungsreserven für das Gesamtsystem. Aufgrund der dezentralen Erzeugung in den Verteilnetzen und den neuen Erzeugungstechnologien ergeben sich hierbei neue Chancen und Herausforderungen. Das Solidaritätsprinzip garantiert die Sicherheit des europäischen Verbundsystems — und dies zu geringen volkswirtschaftlichen Kosten. Diese Solidarität ist auch für den künftigen Betrieb unverzichtbar.“
Grundsätzlich soll diesen Ausführungen nicht widersprochen werden. Die Frage ist nur, wie das Thema Solidarität betrachtet wird und welche Schlussfolgerungen gezogen werden. Der FNN führt hier weiter aus:
„Ein für den Inselbetrieb konzipierter Netzbereich kann während des ungestörten Normalbetriebs des Verbundsystems unter abgestimmten Rahmenbedingungen aus internen Gründen getrennt werden. Eine vorsorgliche Trennung während einer Störung im Verbundsystem verletzt das Solidaritätsprinzip und ist bisher nicht vorgesehen. Denkbar ist ein Inselbetrieb nur im Einzelfall und nach sorgfältiger Bewertung, denn diese Trennung kann die Störung im Verbundsystem verschärfen. Die abgetrennten Inselnetze leisten keinen stützenden Beitrag für das Gesamtsystem, der gerade in kritischen Situationen benötigt würde.“
Diesem Standpunkt kann nicht mehr bedingslos gefolgt werden. Die vollständige Bewertung erfordert eine umfassendere Diskussion und nicht die Postulierung fehlender Solidarität im Energiesystem, ohne zukünftige Verfahren und Möglichkeiten der Digitalisierung in Verbindung mit dem zellularen Ansatz zu betrachten.
Ist der Bau eines Brunnens unsolidarisch?
Die Ausführungen des FNN beziehen sich nicht vollständig auf die Solidarität im Energiesystem. Der zitierte Hinweis fokussiert auf das Stromverbundsystem, das in seiner aktuellen Gestaltung das Rückgrat aller führenden Industrieländer bildet. Dieses Rückgrat wurde aber aufgrund zentraler Energieressourcen (Kohle, Öl, Gas, Uran) über einen Zeitraum von über 100 Jahren zunehmend durch eine überschaubare Anzahl weltweit agierender Großunternehmen gestaltet. Insofern verbergen sich hinter dem Begriff Solidarität sowohl technisch sinnvolle Begründungen als auch rein wirtschaftliche Interessen. Diese Aspekte treffen natürlich auch auf regional ausgeprägte Infrastrukturen zu. Deshalb werden nachfolgend einige Analogien aufgeführt, um daran den Begriff der Solidarität zu bewerten.
Im Stadtrat führten wir in den 1990-er Jahren eine intensive Diskussion, ob in unserer Kleinstadt und zugehörigen Ortschaften in ländlicher Lage nicht ein umfassendes Fernwärmenetz durch das lokale Stadtwerk verbunden mit dem Anschlusszwang für alle Gebäude errichten werden sollte. Grundsätzlich herrschte Einigkeit darüber, dass ein Fernwärmenetz vielen Einwohnern der Stadt eine wirtschaftliche und effiziente Wärmeversorgung bot. Neue effiziente Wärmeerzeugungsanlagen sowie die schrittweise Abschaffung der individuellen Kohleverfeuerung erhöhten die Nachhaltigkeit des Energiesystems der Stadt. Diesen Gesichtspunkten standen die früheren Erfahrungen mit der Planwirtschaft und die Einschränkung individueller Initiativen gegenüber. Konnte es zulässig sein, mögliche private Bestrebungen zum Einsatz anderer innovativer Formen der Wärmeerzeugung aufgrund politischer Beschlüsse zu verbieten? War nicht eine Fernwärmeversorgung ohne Anschlusszwang in Verbindung mit anderen Formen der dezentralen und gleichzeitig nachhaltigen Wärmeerzeugung möglich. Letztendlich entschied sich der Stadtrat mit großer Mehrheit gegen den Anschlusszwang und trotzdem konnte diese Stadt zusammen mit dem eigenen Stadtwerk eine erfolgreiche Fernwärmeversorgung etablieren. Inzwischen beweisen andere Gemeinden, dass die Verbindung von Fernwärme- und Nahwärmenetzen mit dezentraler Wärmeerzeugung sowie auch mit dezentraler Einspeisung von Wärmeenergie in das Wärmenetz erfolgreich und effizient sein kann.
Eine analoge Diskussion folgte bezüglich des Wasser- und Abwassersektors. Die aus Zeiten der ehemaligen DDR stammende Wasserinfrastruktur war äußerst marode. Eine über zehn Jahre gestreckte, umfangreiche Investition in Wasserwerke, Abwasseranlagen und in das zugehörige Rohrnetz der Stadt – wiederum in Verbindung mit umliegenden Ortschaften — sicherte die zukünftige Wasserversorgung mit hoher Qualität. Hieraus resultierte eine deutliche Steigerung der Wasser- und Abwasserkosten für alle Bürger. Aus diesem Grunde waren in der Folge beträchtliche Einsparbemühungen bezüglich der Wassernutzung bei den Bewohnern der Stadt zu verzeichnen. Dies wiederum gefährdete die Finanzierung der Investitionen der Stadtwerke in die modernisierte Infrastruktur. Gleichzeitig konnte die zunehmende Nutzung privater Brunnen im ländlichen Umfeld der Stadt registriert werden, womit die Einnahmen weiter sanken. In der Konsequenz mussten die Wassergebühren umgestellt werden. Der feste Monatsbetrag für den Wasseranschluss stieg, um den Rückgang beim mengenbezogenen Betrag zu kompensieren. Damit stellte sich die Frage: Ist der Bau eines Brunnens unsolidarisch? Wiederum wurde Eigeninitiative gegen Gemeinschaft gestellt. Aber müssen diese beiden Zielrichtungen miteinander kollidieren? Sollten wir uns nicht vielmehr die Frage stellen, wie beide legitimen Ansätze miteinander verbunden werden?
Letztendlich lassen sich diese Betrachtungen für vielfältige Lebensbereiche führen. Aufgabe der Gesellschaft ist es, allen Menschen ein ausreichendes Nahrungsangebot bereitzustellen. Aus diesem Grunde besitzt der landwirtschaftliche Sektor im Budget der EU-Kommission das umfangreichste Budget. Diese Gelder regeln den Anbau von Weintrauben auf der kleinsten griechischen Insel als auch den Kartoffelanbau in der Lausitz. Aber niemand käme auf die Idee, den privaten Lebensmittelanbau im privaten Garten als unsolidarisch zu betrachten.
Differenzen als Antriebskraft gesellschaftlicher Entwicklung
Energie stellt die fundamentale Größe der Physik dar. Physiker können Energie beschreiben, wissen aber nicht wirklich, was im Kern Energie ist. Wir nehmen Energie erst richtig war, wenn sie etwas bewirkt, wenn sie einen Fluss der Veränderung auslöst und Formen schafft. Wir beschreiben Energie damit nicht als irgendeine Substanz, sondern in ihrer Wirkung. Ihre Wirkung basiert aber nur auf Potentialen, die die eigentliche Fähigkeit zur Wirkung ausdrücken. Potentiale bedeuten Differenzen bezüglich der an verschiedenen Orten unterschiedlichen Fähigkeit Arbeit zu verrichten. Wenn die Fähigkeit zur Erzielung von Wirkung an allen Orten gleich wäre, würde es keine Energieflüsse geben. Erst die Differenzen führen zur Wirkung und damit zur Schaffung von Gestalt durch Energie, die Arbeit verrichtet. Differenzen sind als eine Art potentielle Form Ursache der Entwicklung, während Energie die Wirkung darstellt, durch die Gestalt als materielles Ergebnis entsteht.
Insofern müssen wir uns fragen, ob der stetige Prozess der Wandlung lokaler menschlicher Kulturkreise mit lokalen Wirtschaftskreisläufen und unterschiedlichsten politischen Ausgestaltungsformen der Gesellschaft zu einer globalisierten und völlig vereinheitlichten Welt vollständig gestützt werden kann. Leider wird der Begriff der Solidarität oft nur mit gemeinsamen und gleichen Verfahren in Verantwortung weniger Akteure verbunden. Die positive Zielstellung gleicher Möglichkeiten für alle Menschen darf nicht zu einem Einheitssystem führen.
Anderseits bedeutet völlig lokales Denken die Entwicklung eines geschlossenen Systems, dem der Input der Umgebung fehlt. Das System kann sich dann nur noch innerhalb seiner Grenzen entwickeln. Wenn dieses lokale System in sich wiederum einheitliche Mechanismen hat, verliert es ebenso Differenzen und das lokale System erstarrt.
Wir schließen daraus, dass völlig lokal zentrierte Systeme mit einem stark ausgeprägten Eigenbezug ebenso bezüglich ihrer Entwicklungsfähigkeit erstarren, wie dies ein völlig globalisiertes System ohne ausreichende interne Differenzen und ohne externe Beeinflussung tut. Diese Erkenntnis reifte zum zellularen Ansatz für ein Energiesystem als Energieorganismus, bestehend aus autonomen Zellen. Weder ein vereinheitlichtes Verbundsystem noch ein reines Inselsystem autarker Energiekreisläufe erreicht das Optimum. Aber ebenso bedeutet Autonomie die Fähigkeit zur Inselbildung, um Flexibilität im Energieorganismus unter allen Bedingungen zu erhalten. Die Inselfähigkeit ist deshalb zwingend in einem zellularen Energiesystem auszubilden.
Die Kunst eines innovativen und entwicklungsfähigen Systems besteht somit darin, lokal als eigenständiges System zu agieren, aber gleichzeitig die globale Vernetzung für genügend externe Beeinflussung anzustreben. Differenzen befördern die Entwicklungsfähigkeit abgeschlossener stabiler Einheiten, wenn gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen wird, Grenzen vielfältig zu überspielen. Damit aber ein umfassendes und einheitliches System der menschlichen Gesellschaft auf dem Planeten Erde nicht ohne externen Einfluss erstarrt, sind Differenzen und damit auch Grenzen zu gestalten. Es wird eine transparente Hülle des Systems benötigt. Der Leitspruch dieses Denkens lautet: Handle lokal und denke global!
Dies beschreibt angewendet auf das Energiesystem komprimiert das Ziel des zellularen Ansatzes. Letztendlich bedeutet dieses gesellschaftliche Denken die Verbindung von Handlungen in regionalen Kreisläufen als selbstständige Energiezelle zu verbundenen Energiekreisläufen im nationalen als auch globalen Energieorganismus.
Das politische Projekt für ein solches Energiesystem besteht darin, Differenzen zuzulassen sowie gleichzeitig Verbundenheit zu befördern.
Solidarität im Energiesystem oder führt der zellulare Ansatz zu Egoismus?
Ein Stromverbundsystem ist volkswirtschaftlich sinnvoll, Versorgungssicherheit befördernd und solidarisch für die Angehörigen der Gesellschaft, denen nicht die gleichen Mittel zur Eigengestaltung gegeben sind, wie ihren Nachbarn.
Autonomie zu gestalten ist jedoch ein natürlicher Prozess der Schaffung von Differenzen, der sowohl individuelle als auch gesellschaftliche Entwicklung befördert.
Der Forderung kann somit nicht darin bestehen, den einen Weg gegen die andere Lösung zu stellen. Stattdessen sollte die Vereinigung beider Zielstellungen ermöglicht werden. Ein zu unflexibles Stromsystem im Sinne starrer technischer Lösungen sowie auch zu starrer regulatorischer und gesetzlicher Festlegungen kann dieser Vereinigung entgegenstehen.
Der zellulare Ansatz geht davon aus, dass in physikalisch abgegrenzten Strukturen verschiedene lokale Möglichkeiten der Gewinnung von Endenergie in Form von Strom, Wärme oder Treibstoffen existieren. Eine die Energie transportierende Infrastruktur verbindet dabei innerhalb der Zelle die Möglichkeiten der Wandlung der Energieformen untereinander und der Speicherung mit den verschiedenen Formen der Energienutzung. Dazu gehört ein intelligentes Management der Energieflüsse. Es gewährleistet den effektiven und effizienten Energieeinsatz innerhalb der Zelle sowie auch die Steuerung der Energieflüsse über die Zellgrenzen hinaus in die verbundene Außenwelt. Integrierende Komponenten wiederum organisieren den Systemverbund und übernehmen Verantwortung zur Einhaltung gemeinsamer Regeln.
Selbstverständlich gehören dazu die Verfahren zur Erhaltung des Systemverbundes auch unter den Bedingungen eines zellularen Energiesystems. Dies umfasst bei Ausfällen von Teilbereichen im Stromsystem die Erhaltung in anderen Teilbereichen sowie den Wiederaufbau des Gesamtsystems nach der Störungsbeseitigung. Aber im Sinne der Verbindung von Solidarität im Gesamtsystem mit der Gewährleistung von Eigengestaltung ist auch der Inselbetrieb einer Zelle bei externen Ausfällen zuzulassen.
Die Bildung einer lokalen Zelle hat mehrheitlich nicht das Ziel, eine ständig autark agierende Zelle aufzubauen. Dies ist weder wirtschaftlich noch kann Versorgungssicherheit individuell ebenso weitgehend gestalten werden, wie im solidarischen Verbundsystem. Eine autonom gestaltete Zelle zieht die Motivation aus der eigenen Gestaltungsmöglichkeit als auch aus der Nutzung des die Gemeinschaft schützenden Daches.
Gewährleistung von Solidarität im Energiesystem sowie von Eigeninitiative
Der oft aufgebaute Antagonismus von Solidarität im Verbund und vom angeblichen Egoismus der Energiezelle basiert auf der heutigen Finanzierungsbasis des gemeinsamen Netzes. Das System nutzt ein Finanzierungsverfahren, das über Zellgrenzen hinweg fließende Energiemenegen berechnet. Eigenversorgung muss somit schädlich für das Gesamtsystem und damit scheinbar unsolidarisch sein, weil die Finanzierung in Frage gestellt wird. Ein Verfahren, dass auf Anschlusskosten basiert und nicht auf über Grenzen fließende Energiemengen würde dieses Problem sofort lösen. Dazu wird noch einmal an die obigen Beispiele zur Wärme- und Wasserinfrastruktur erinnert.
Eine veränderte Finanzierungsbasis wird an dieser Stelle nicht betrachtet und erfordert weitere umfangreiche Untersuchungen. Hier soll nur auf eine entsprechende Quelle [Rifkin, J. (2016)] aufmerksam gemacht werden, die die gesamtgesellschaftliche Finanzierung gemeinsamer Infrastrukturen unabhängig von deren Nutzungsgrad vorschlägt. Die Infrastruktur stellt die gemeinsame Basis zur Verfügung und schafft Kanten zur Verbindung von Knoten eines Energienetzwerkes. Die Knoten in Form lokaler und regionaler Energiezellen sind Herr der Gestaltung ihrer Energieflüsse und damit Quelle vielfältiger Innovation.
Natürlich betrachten Regeln zur Autonomie sowie bei Störungen zur teilweisen Autarkie das Thema Inselbildung nicht nur aus der Finanzierungsperspektive. Der zu Beginn des Kapitels zur Solidarität im Energiesystem zitierte FFN-Hinweis bezieht sich auch auf die Probleme beim Wegfall von Potentialen zur Netzstützung und zum Netzwiederaufbau nach Ausfällen von Netzbereichen. Wenn zusätzlich funktionierende Netzknoten in Form autonom handelnder Energiezellen den Weg zur Autarkie beschreiten, um als Insel bis zur Wiederherstellung des umgebenden Netzes zu existieren und sich dann wieder mit dem externen Netz synchronisieren, fehlen im umgebenden Netz Potentiale. Die Ursache besteht in einem Netz, das bisher mit einer relativ starren Kopplung der Netzknoten errichtet wurde. Aber Wege zur Errichtung flexiblerer Stromnetzwerke werden national [PEN (2018)] und international [DIGGRID (2018)], [QGRID (2018)], [TE (2018)] beschritten. Im Arbeitskreis Energieversorgung 4.0 der Energietechnischen Gesellschaft des VDE führt Dr. Thomas Walter dazu Folgendes aus:
„Unter dem Programm „Cleaner and Cheaper Energy for Islands“ kümmert sich die Brüsseler Generaldirektion Energie gerade um die ca. 15 Mio. Europäer, die als Endkunden an 2700 Inselnetzen angeschlossen sind [CLEN (2018)]. Auch wenn viele davon mit dem Kontinentalsystem verbunden sind und damit ähnliche Zellsysteme wie diese in Deutschland diskutiert werden (darunter alle deutschen Inseln), sind viele Netze doch isolierte Inselsysteme. Zu den größeren Inselsystemen gehört Gran Canaria mit 800.000 Netzanschlüssen. Kleineren Lösungen reichen bis zu der übrigens elektrisch bereits völlig fossil-freien Hebrideninsel Eigg in Schottland mit 48 Bewohnern. Inselnetze lassen sich sehr viel wirtschaftlicher dekarbonisieren als Kontinentalsysteme und werden daher der weiteren Entwicklung kontinentaler Verbundsysteme um Jahre vorauseilen.
Weltweit verstärkt sich sogar der Bedarf nach Inselkonzepten. Zehn Prozent aller Menschen (also über 700 Mio im Jahre 2017) leben laut der Datenbank des Reiner-Lemoine-Instituts in Berlin auf Inseln. Nicht mitgezählt werden dabei die Off-Grid Netze auf dem Festland auch in hochentwickelten, aber dünn besiedelten Gebieten wie Australien (Perth) oder Alaska. Daraus folgt eine Riesenchance auch für deutsche Technologienstrengungen, die ein effizientes Zellmanagement ermöglichen.“
Die Kopplung von Solidarität im Energiesystem und Gewährleistung von Eigeninitiative in Verbindung mit wirtschaftlichen Chancen neuer energiebezogener Technologien und der Digitalisierung sollte es wert sein, diese Wege zu untersuchen und in Pilotprojekten einzusetzen sowie deren Anwendbarkeit zu bewerten.
Quellen
CLEN (2018). Clean Energy for EU Islands — Inaugural Forum. https://ec.europa.eu/energy/en/events/clean-energy-all-european-islands-inaugural-forum — geladen am 27.03.2018
DIGGRID (2018). What is the Digital Grid — The “Internet of Energy”. http://www.digitalgrid.org/en/ — geladen am 26.03.2018
PEN (2018). PolyEnergyNet – Resiliente Polynetze zur sicheren Energieversorgung. http://www.polyenergynet.de/ — geladen am 27.03.2018
QGRID (2018). Quantum Grid – Das Energie Internet, https://www.gip.com/de/quantum-grid.html — geladen am 26.03.2018
Rifkin, J. (2016). Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft (27. April 2016). FISCHER Taschenbuch. ISBN-13: 978–3596033676
TE (2018). Transactive Energy: The next step for the digital grid? https://www.cleantech.com/transactive-energy-the-next-step-for-the-digital-grid/ — geladen am 26.03.2018
Andreas Kießling, Leimen, 27. Juni 2018