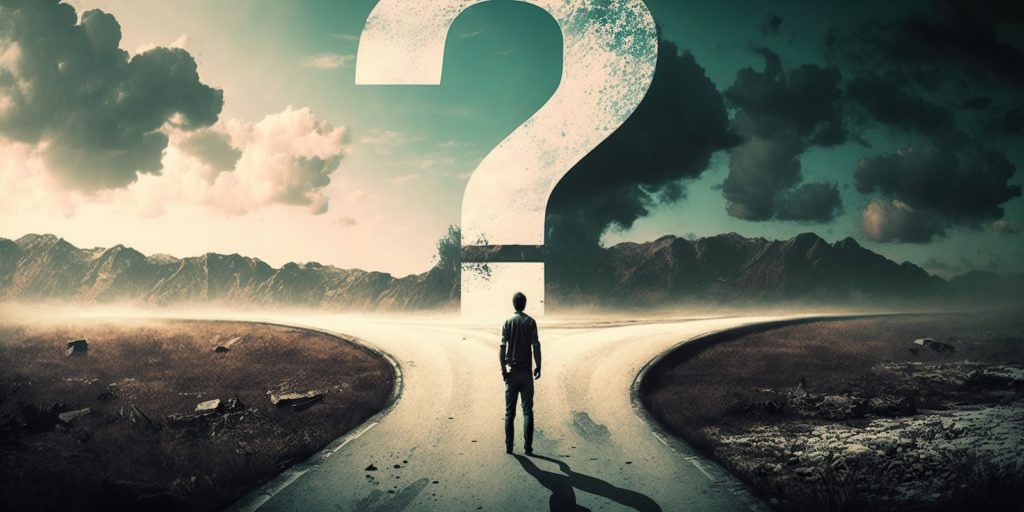Gestaltung von Energielandschaften
Die Frage, in welcher Weise der Gestaltung von Landschaften benötigte Energie in Form von Elektrizität und damit als Differenzen zwischen Orten der Erzeugung von Elektrizität und der Nutzung dieser Energie angeboten werden soll, stellt sich seit Beginn des Aufbaus des Energiesystems auf Grundlage der Konzepte von Thomas Edison und Nikola Tesla. Edison leitete den weltweiten Prozess der Elektrifizierung am Ende des 19. Jahrhunderts in New York mit der Gleichstromtechnik ein. Da diese Technik bei Transporten über große Distanzen mit hohen Verlusten verbunden war, basierte das ursprüngliche Konzept des Energiesystems auf einem dezentralen Ansatz mit vielfältigen Erzeugungsanlagen. Ebenso entwickelte Nikola Tesla Ende des 19. Jahrhunderts die Wechselstromtechnik, die mit Unterstützung des erfolgreichen Unternehmers Georg Westinghouse als Konkurrenz zum Ansatz von Thomas Edison sehr schnell Verbreitung erfuhr. Da die Wechselstromtechnik Ferntransporte mit weit geringeren Verlusten umsetzen konnte, ermöglichte dies den Aufbau sogenannter Zentralkraftwerke. Zwischen Edison auf der einen Seite sowie Westinghouse und Tesla auf der anderen Seite entwickelte sich der sogenannte Stromkrieg. Letztendlich fusionierte die von Edison gegründete Firma General Electric aus wirtschaftlichen Gründen mit anderen Unternehmen, die Technologie und Patente zur Wechselstromtechnik einbrachten, womit der Siegeszug des Wechselstroms vollendet war.
Herkunft des zentralen Energiesystems
Da der Antrieb der Generatoren zur Erzeugung elektrischer Energie damals weitgehend durch mit Kohle befeuerte Dampfmaschinen erfolgte, war die Errichtung zentraler Kraftwerke unter Nutzung der Wechselstromübertragungstechnik zum Transport an die weit entfernt angesiedelten Nutzer ein logischer Prozess. Die Konzentration der Vorkommen an Kohleflözen als Energiequellen und die Notwendigkeit wirtschaftlicher Prozesse zur Aufbereitung und Verbrennung der Primärenergie Kohle begünstigte die Entwicklung der zentralen Erzeugung zur Endenergie Elektrizität. Jane Jacobs spricht auch von der damaligen Inkonsequenz, bestehende Probleme wirklich lösen zu wollen. Die Probleme, welche die Industrialisierung mit sich brachte, wurden lediglich ausgelagert. Die Distanz zwischen Energieerzeugung und urbanen Lebensräumen war im damaligen Sinne „logisch“, da Energieerzeugung auch etwas Ungesundes mit sich brachte. Jedoch wurde der Gedanke des „Außens“ gegenüber der Stadt als geschlossenem System durch einen rasanten Prozess der Urbanisierung aufgelöst, und somit wurde das ausgelagerte Problem wieder verinnerlicht.
Damit entwickelte sich ein Energiesystem mit wenig Varianten und binärer Form der Differenzierung. Auf der einen Seite stehen wenige Unternehmen, die aus Energiequellen die Primärenergie aufbereiten und diese der Erzeugung von Endenergie zuführen. Die Infrastruktur zum Ferntransport der Energie liegt in regulierten, monopolistischen Organisationsformen und wird als Einbahnstraße betrieben. Der Strom ist ausgehend von Orten zentraler Erzeugung über Weitverkehrsnetze zu transportieren und dann über Verteilungsnetze in den Siedlungszonen an die Nutzer zu verteilen. Die klare binäre Differenzierung mit festen Prozessen und Strukturen führte zu sehr eingegrenzten Möglichkeiten der Entwicklung des Energiesystems, das bei grundsätzlicher Betrachtung seit über einem Jahrhundert seine Form beibehielt.
Paradigmenwechsel zu dezentralen Energiesystemen
Seit Beginn des 21. Jahrhunderts ändert sich die Situation und das Energiesystem erfährt eine grundlegende Transformation. Erneuerbare Energien wie Wind und Sonne, aber auch Erdwärme, Biomasse oder das energetische Angebot von Wasser in vielfältiger Form sind weitgehend überall vorhanden und nicht auf wenige Orte der Extraktion von Primärenergie konzentriert.
Besonders in Deutschland reifte seit 2010 unter den Bedingungen eines stark wachsenden Anteils an dezentraler Erzeugung — beispielsweise Photovoltaik — in den Siedlungsgebieten, mit Netzrückkäufen durch die Gemeinden sowie mit regionalen und lokalen Energiekonzepten in den Bundesländern, den Regionen und Kommunen aber auch bei den Bürgern und Unternehmen die Erkenntnis, dass im Kern die Fragestellung zu beantworten ist, wo die Transformation des Energiesystems stattfindet. Gilt es, das zentral orientierte Energiekonzept zu erhalten, das in Europa eine vorrangige Energiegewinnung in Nord- und Ostsee durch Windnutzung sowie im Mittelmeerraum durch Nutzung der Solarenergie zuzüglich des damit verbundenen Energietransportes von Nord nach Süd bei Ausbau der Übertragungsnetze vorsieht, oder können dezentrale Energiekreisläufe eine neue Renaissance erfahren?
Ein oft gehörtes Argument zugunsten regionaler Konzepte unterstreicht den eventuell verringerten Netzausbau. Es gibt aber weitere Gründe für eine komplexere, sozioökonomische Betrachtung, um den gesellschaftlichen und ökonomischen Zusammenhang herzustellen, wenn es darum geht, mit den Regionen und Kommunen sowie den Unternehmen und den Bürgern alle Interessenträger für die ökologischen und energiepolitischen Ziele beim Umbau des Energiesystems zu aktivieren und damit Chancen statt nur Notwendigkeiten zu betonen. Hier gilt es auch, den Vorteil der Diversifizierung der Energieangebote zur Gewährleistung von Versorgungssicherheit gegenüber zentralen, angreifbaren Systemen abzuwägen. Dabei sollte man sich auch vergegenwärtigen, dass die Energiefrage im Kern eine Gerechtigkeitsfrage ist. Zur Beurteilung eines Energieversorgungssystems sind die drei Themen intakte Umwelt (Nachhaltigkeit der Systementwicklung), soziale Faktoren (Energiezugriff und Sicherheit) sowie gesunde Wirtschaftskraft (ökonomisches Wachstum und Entwicklung) zu betrachten [World Economic Forum, 2013]. Letztendlich basieren menschliche Grundbedürfnisse auf dem Zugang zu Energie. In einer globalen und vernetzten Welt gilt es, bezahlbaren und gerechten Zugang zu nachhaltiger Energie für alle Menschen zu gewährleisten, weshalb eine ausgewogene Balance zwischen Globalisierung und Subsidiarität herzustellen ist.
Neue Chancen für nachhaltiges Wachstum
Die Notwendigkeiten zur Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit erzeugen einen starken Druck auf das existierende Energiesystem. Sie bieten aber bei offener Sichtweise auf das gesellschaftliche Gesamtsystem höchste Chancen für neues ökonomisches Wachstum mit zusätzlichen Wertschöpfungsmöglichkeiten trotz gleichzeitiger Senkung der Ressourcenverbräuche.
Wachstum sowie Schonung des natürlichen Kapitals der Erde sind kein Gegensatz. Dabei gilt es, Verbundsysteme zu sichern, da sie mit ihren ausgleichenden Effekten dazu beitragen, die Versorgungssicherheit auf einem hohen Stand zu halten. Sicherheit im Verbundsystem und wirtschaftliche Chancen für vielfältige Akteure durch Subsidiarität auf Basis eines effizienteren, auf erneuerbaren Energien beruhenden Energiesystems sind zu vereinigen. Subsidiarität und Verbundenheit führen zum Vorschlag eines Energiesystems mit regionalen Erzeugungs‑, Speicherungs- und Ausgleichsmechanismen im Verbund von Strom, Gas, Wärme und Mobilitätskonzepten sowie der Abstimmung zwischen regionalen Interessen, aber auch gesamtstaatlicher Interessen sowie internationaler Ansprüche in Verbundnetzen.
Die Gestaltung des Energiesystems erfolgt auf dieser Basis auch in bedeutendem Maße von unten nach oben. Ein nur aus zentraler Sicht festgelegtes, starres System führt zu mangelnder Akzeptanz und verhindert Partizipation breiter Interessengruppen zu Gunsten weniger Akteure. Eine sozioökonomische Betrachtung versteht dabei, dass Akzeptanz für den Änderungsprozess durch neue Energietechnologien und durch die informationstechnische Vernetzung des Energiesystems nicht allein mit einer Aufklärungsoffensive zur Darstellung der Notwendigkeiten einer weiter zentral aufgestellten Energiegewinnung mit einseitiger Verteilung der wirtschaftlichen Chancen zu erreichen ist. Akzeptanz entsteht durch Teilhabe, und Teilhabe entwickelt Prosumenten im Energiesystem mit neuen Formen der Gebäude- und Landschaftsentwicklung. Es ist also die gesellschaftliche Grundsatzentscheidung zu treffen, wie zentral oder dezentral Energiekreisläufe zukünftig funktionieren. Im Fall der Beförderung regionaler und lokaler Energiekreisläufe besteht die umfassende Aufgabe darin, zentral und dezentral erzeugte Energie in den Verbund nationaler und internationaler Energiekreisläufe zu integrieren sowie Energieeffizienz auf allen Handlungsebenen zu erhöhen. Eigenständigkeit und Verschiedenheit im lokalen Handeln mit selbst gestalteten Energiekonzepten sind ebenso zu unterstützen, wie es auch gilt, Verbundenheit im globalen Denken zu fördern.
Verhältnis von Autarkie und Verbundenheit
Das Ziel besteht nicht darin, ausschließlich autarke, nebeneinander existierende Energiekreisläufe zu entwickeln. Ein reiner Individualismus führt zu verringerter Versorgungssicherheit, da ausgleichende Effekte zwischen Energieverbünden verloren gehen. Gleichzeitig stärken aber autonomiefähige, weitgehend selbst organisierte Energiesysteme im Netzverbund das Gesamtsystem, da lokale und regionale Mechanismen, Produkte und Verantwortlichkeiten die Flexibilität und Effizienz des Energiesystemverbundes durch Diversifizierung und Eigenverantwortlichkeit in einer Art Organismus erhöhen.
Nun schließt sich wieder der Kreis zur Betrachtung der Differenzen. Im dezentralen Konzept entstehen Differenzen und damit lokale Möglichkeiten der Gestaltung in Gebäuden, Ortschaften und Regionen mit vielfältigen, kleineren Energiekreisläufen zwischen Quellen und Nutzungssenken von Energie. Energiekreisläufe interagieren aber in zukünftig bidirektional betriebenen Netzen miteinander. Diese zusätzlichen Differenzen führen zu neuen Gestaltungsmöglichkeiten in der Stadt-/Landbeziehung bis hin zu neuen nationalen und internationalen Beziehungen.
Hieraus wurde die Analogie zum zellularen System im Energieorganismus abgeleitet, der die Entfaltung vielfältiger neuer Formen auf Grundlage vielfältiger Differenzen ermöglicht.
Energiezellen bilden sich einerseits in Gebäuden, Stadtteilen, Kommunen und Regionen mit selbstoptimierenden Energiekreisläufen, die anderseits regional und in eingebetteter Weise auch überregional miteinander verbunden sind und somit den Energieorganismus entwickeln. So lassen sich regionale Interessen für eigenständige Chancen in der energiewirtschaftlichen Wertschöpfung, Versorgungssicherheit und Informationssicherheit durch diversifizierte Strukturen sowie Datenschutz und Minimierung der Datenflüsse zu zentraleren Strukturen verbinden. Dies wird durch eine selbst abbildende, fraktale Struktur beschrieben, die es ermöglicht, das mit der Dezentralität zunehmend komplexere System in einem global kontrollierbaren Rahmen zu organisieren. Gebäudenutzer, Unternehmen, Städte und Regionen entwickeln sich somit zu Prosumenten, die durch eine passende Gestaltung des Marktes oder der Community zum gemeinsamen Handeln in einem Energieverbund angeregt werden.
Lokale und regionale Energiekreisläufe ermöglichen auf der Grundlage vielfältiger Differenzen sowie unterschiedlicher kultureller Rahmenbedingungen und Zielstellungen die Gestaltung unterschiedlicher Formen der Integration des Energiesystems in die Gebäude- und Landschaftsgestaltung. Der durch Informationsaustausch zwischen Prosumenten organisierte Energieaustausch bietet umfassende Chancen zu einem effizienteren Umgang mit Energie und neuen Formen der Ökonomie bei zunehmender Wertschöpfung in den Regionen und breiter Beteiligung als eine Art Teilhabe-Ökonomie.
Kießling, Andreas (Hrsg.).; Hartmann, Gunnar (2013). Energie zyklisch denken. Etwa 130 S., E‑Book (Amazon). Leimen. 01.10.2013. ISBN 978–3‑00–047441‑5.