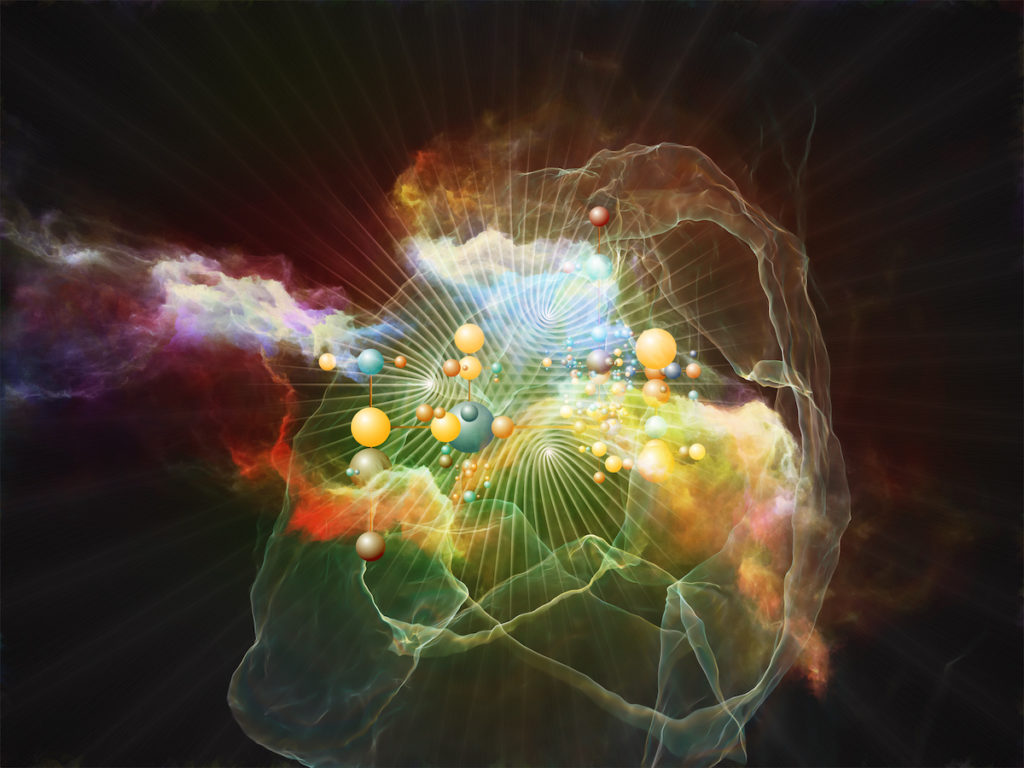Fundamente aller Energiequellen
Was die Welt im Innersten zusammenhält
„Daß ich erkenne was die Welt, im Innersten zusammenhält“ Johann Wolfgang von Goethe: Faust — Der Tragödie erster Teil
Die Frage nach Beschaffenheit und Funktion grundlegender Bausteine der Welt spielte schon lange vor dem Aufkommen der modernen Physik eine große Rolle im Leben der Menschen. Die Schritte zur Beantwortung dieser Fragen, insbesondere in Bezug auf die Fundamente aller Energiequellen waren auch immer Treiber der Nutzung neuer Formen zur Energiegewinnung und damit des menschlichen Fortschrittes.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Was ist Energie?
- Energieatlas
- Ursache von Energie
- Fundamente aller Energiequellen
- Energiequellen im Zeitenwandel
- Nachhaltigkeit und der Blick in die Vergangenheit (Energiequellen im Zeitenwandel — Teil 1)
- Entstehen, Existenz und Vergehen der Sterne als Energiequellen (Energiequellen der Gegenwart)
- Neue Möglichkeiten am Horizont und die Zukunft ist offen
- Erneuerbare Energie im Überblick
- Direkte Nutzung der Sonnenstrahlung
- Bewegungsenergie des Windes
- Bewegungsenergie und chemische Energie von Meerwasser
- Bewegungsenergie von Fließwasser
- Wärmeenergie der Erdkruste
- Chemische Energie der Biomasse
- Fortsetzung folgt …
Energiequellen und gesellschaftliche Debatte
Nach Klärung des Begriffes Energie betrachten wir die Fundamente aller Energiequellen, um später auf deren Nutzung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einzugehen. Dem Leser ist sicherlich die Einordnung der Primärenergiequellen in die Kategorien fossile Energie, Kernenergie und erneuerbare Energie bekannt. Die meisten Staaten sind sich darin einig, dass der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energie zur Eindämmung des Klimawandels zwingend notwendig ist. Aber bereits der Einsatz von Kernenergie offenbart die nationalen Unterschiede. Die Nutzung erneuerbarer Energie wird mit unterschiedlicher Geschwindigkeit vorangetrieben. Doch erfassen diese Kategorien schon alle Möglichkeiten der Zukunft? Welche Rolle spielt zukünftig die Kernfusion? Welche neuen Ideen folgen aus Erkenntnisfortschritten der Physik?
Die umfassende Behandlung dieser Fragestellungen überschreitet den Rahmen der Artikelserie. Trotzdem ist ein Grundverständnis notwendig, um Entscheidungen zur Umsetzung von Energiekonzepten treffen zu können. Diese Entscheidungen sind im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext zu treffen. Die dabei einzubeziehenden Parameter betreffen nicht nur technische Fragen. Sie sind sowohl in Bezug auf die aktuelle gesellschaftliche Wirklichkeit sowie verschiedener, denkbarer Zukünfte zu fällen. Beispielsweise wurde in Deutschland mühevoll um einen Konsens gerungen, der den schnellen Ausstieg sowohl aus Kernenergie als auch aus fossiler Energie vorsieht. Trotzdem gibt es gesellschaftliche Gruppen, die den Einsatz dieser Energiearten weiter befürworten. Dabei geht es um die Fragestellung, ob die Freiheit des Handelns der heutigen Generation einer zukünftig prosperierenden und lebenswerten Welt entgegensteht. Die Frage lautet, ob wir die Konsequenzen heutigen Handelns an die Innovationskraft unserer Kinder übergeben können.
Anworten auf die damit verbundenen gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen werden hier nicht gegeben. Wir werden uns vorrangig auf den aktuellen politischen und technologischen Stand der Diskussion beziehen und Beispiele zur Konzeption und Umsetzung von Energielösungen auf Basis erneuerbarer Energien anführen. Gleichzeitig soll aber der Blick für Möglichkeiten der Zukunft und die Wege anderer Staaten offenbleiben. Dazu dient die folgende, kurz gefasste Betrachtung der Fundamente aller Energiequellen. Auf dieser Basis werden wir später Lösungen untersuchen, die in der Vergangenheit genutzt wurden, heute den Systemwechsel beschreiben oder zukünftig eventuell zur Nutzung bereitstehen.
Was die Welt im Innersten zusammenhält
Das einführende Kapitel zum Energieatlas beschrieb den Prozess der Energietransformation in sechs Schritten als Zyklus. Mehrere dieser Transformationen lassen sich als wiederholte Zyklen aneinanderreihen. Dabei geht Energie nicht verloren. Aber jede Wandlung von Energie in eine andere Art vermindert den Anteil nutzbarer Energie. Nicht mehr zur Nutzung verfügbare Energie bleibt zurück. Deshalb werden Lösungen mit einem möglichst hohen Anteil nutzbarer Energie nach Vollendung eines Zyklus gesucht.
Um keine Energiequellen zu übersehen, gehen wir zu Beginn gemeinsam ein Stück schwierigen Weges. Dieser Pfad startet in den Tiefen der Physik mit Wechselwirkungen, die die Welt im Innersten zusammenhalten und letztendlich die eigentlichen Quellen als Fundamente aller Energiequellen bereitstellen.
Die Physik umfasst eine große Breite an Teildisziplinen. Doch im Kern unterscheiden die Wissenschaftler nur vier fundamentale Wechselwirkungen, die auch Grundkräfte genannt werden. Auf dieser Basis werden alle Phänomene der real existierenden, physischen Welt beschrieben. Sie sind Ausgangspunkt zur Beschreibung aller physikalischen, chemischen und biologischen Vorgänge.
Bekannt sind diese Wechselwirkungen unter den Begriffen
- Gravitation
- Elektromagnetismus
- schwache Wechselwirkung (auch schwache Kernkraft genannt)
- starke Wechselwirkung (auch starke Kernkraft genannt)
Gravitation und Elektromagnetismus
Isaak Newton dachte über die Kräfte zwischen Massen nach, als ihm laut Legende während der Isolierung auf seinem Landsitz zur Zeit der Pest ein Apfel auf den Kopf fiel. Er entdeckte und formulierte die Gesetze der Gravitation. Auf die Nutzbarkeit von Massen als Energiequellen aufgrund der Gravitation werden wir noch umfangreich eingehen.
Ohne Elektrizität und Magnetismus ist die moderne Gesellschaft nicht denkbar. Die aus der Verbindung dieser beiden Phänomene zum Elektromagnetismus resultierende Erscheinungen übertragen Energie drahtlos über elektromagnetische Wellen. Anziehung und Abstoßung elektrisch geladener Teilchen im Zusammenwirken mit magnetischen Wirkungen bewirken aber auch die Übertragung von Energie über Leitungen als auch die Drehung von Elektromotoren. Speicher mit positiv oder negativ geladenen Teilchen als auch Magneten bilden somit Energiequellen.
Starke Kernkraft
In der klassischen Physik haben die Gravitation seit den 1680er Jahren und der Elektromagnetismus seit den 1870er Jahren eine mathematisch fundierte Grundlage. Im Gegensatz dazu erlaubte erst die moderne Physik auf Grundlage der Quantenmechanik seit den 1930er Jahren die Untersuchung und Klärung der Prozesse in Bezug auf die starke und schwache Kernkraft.
Eigentlich stoßen sich elektrisch positiv geladene Protonen im Atomkern als Folge der elektromagnetischen Wechselwirkung ab. Dass der Atomkern dennoch zusammenhält, liegt an der starken Wechselwirkung. Bei großen Atomkernen kann es aber trotzdem zum Zerfall in zwei kleinere Atome und in Neutronen kommen. Da die neuen Atome zusammen leichter als das Ausgangsatom sind, wird laut der bekannten Gleichung von Einstein, dass Energie gleich der Masse mal dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit ist, Bewegungsenergie der Zerfallsprodukte frei. Dieser Vorgang wird als Kernspaltung beschrieben. Dabei wird in der Regel Uran als Energiequelle genutzt.
Der Ablauf funktioniert auch in der anderen Richtung. Zwei leichte Atomkerne können miteinander durch Energieeinsatz zur Überwindung der abstoßenden starken Wechselwirkung zu einem neuen Atom verschmelzen. Dabei wird mehr Energie frei als zur Verschmelzung eingesetzt. Im Gegenzug ist das Verschmelzungsprodukt leichter als die Ausgangsatome. Beispielsweise verschmelzen zwei Wasserstoffatome zu Helium. Dieser Prozess bildet Sterne. Die Sonne ist eine Energiequelle mit dem Energieträger Wasserstoff. Der direkte Einsatz von Wasserstoff sowie anderer leichter Elemente auf der Erde unter Nutzung der Kernverschmelzung – Kernfusion – befindet sich auf dem Wege der technischen Umsetzung.
Schwache Kernkraft
Von der schwachen Wechselwirkung sprechen Physiker, wenn sich Elementarteilchen umwandeln. Zum Beispiel kann sich im Atomkern des chemischen Elements Strontium ein Neutron spontan zum Proton wandeln, womit sich ein anderes chemisches Element, das Ytrium, bildet. Ein Elektron wird freigesetzt, dessen Bewegungsenergie als Primärenergie genutzt werden kann.
Wiederum existiert auch ein umgekehrter Prozess. Dabei wandelt sich ein Proton in ein Neutron sowie in das Gegenstück zum Elektron, das Positron. Dieses positiv geladene Teilchen ist nun der Träger von Bewegungsenergie als Primärenergie.
Die Freisetzung von Elektronen und Positronen durch Umwandlungsprozesse in Atomkernen wird auch als Beta-Strahlung bezeichnet.
Schlussendlich können Atomkerne auch durch die Freisetzung sogenannter Alpha-Strahlung ihre Ordnungszahl ändern und somit in neue chemische Elemente umgeformt werden. Alpha-Strahlen bestehen aus zwei Protonen und zwei Neutronen, der Struktur von Heliumkernen. Dieser Prozess führt somit ebenso zu einer Teilchenstrahlung mit nutzbarer Bewegungsenergie.
Radioaktives Material bildet also eine Energiequelle, die über verschiedene Zerfallsprozesse der Atomkerne zu Zerfallsprodukten als Energieträger führt. Diese Produkte sind Elementarteilchen, deren Bewegungsenergie als Primärenergie für weitere Umwandlungsprozesse von Energiezyklen genutzt werden kann.
Vier, Drei, Zwei, Eins oder mehr?
Mit der Gravitationstheorie von Isaak Newton sowie den Untersuchungen von Faraday zur Elektrizität und zum Magnetismus sprachen die Physiker noch von drei Kräften. Der Mathematiker Maxwell schuf auf Grundlage der experimentellen Arbeiten von Faraday die elektromagnetische Theorie. Mit dem Wechsel zum 20. Jahrhundert war unter vielen Physikern die Überzeugung verbreitet, die Welt komplett beschreiben zu können. Doch schnell zeigten sich nicht mit der klassischen Theorie erklärbare Phänomene.
Zuerst entwickelte Albert Einstein mit der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie die Gravitationstheorie weiter. Zusätzlich stellte die im Jahre 1926 das Licht der Welt erblickende Quantenmechanik die theoretische Grundlage zur Erklärung der schwachen und starken Kernkraft und damit der Vorgänge im Atomkern. Somit waren es vier Kräfte. Doch Physiker suchen aber gern die eine Weltformel, die alles beschreibt. Die entsprechenden Anstrengungen führten bald zur Theorie der elektroschwachen Wechselwirkung, die Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft auf gemeinsame theoretische Füsse stellte. Nun waren es nur noch Drei. Bald gelang es auch die starke Wechselwirkung in eine gemeinsame Theorie einzubeziehen. Es waren nur noch Zwei.
Wir werden uns damit nicht weiter belasten, da es bei der Suche nach Energiequellen aktuell nicht weiterhilft.
Doch ein Schritt fehlt noch. Seit den 1980-er Jahren betreiben Physiker auf Basis verschiedener Ansätze Anstrengungen die Arbeiten von Albert Einstein zur Gravitation mit der gemeinsamen Theorie von Elektromagnetismus und Kernkräften zu vereinen. Das Ziel besteht darin, letztendlich alle Erscheinungen der Realität mit einer Theorie zu erklären, um die eine ursprüngliche Energiequelle beschreiben zu können. Auf diesen theoretischen Pfad müssen wir uns nicht begeben. Doch ein Fakt kann nicht unerwähnt bleiben.
Die Erfolge der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie bei der Erforschung des Weltalls im Verbund mit moderner Mess- und Computertechnik sowie der Raumfahrt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeigten bald auch die Grenzen des bisherigen Wissens auf.
Dunkle Materie und dunkle Energie
Das Universum wurde inzwischen mit modernen technischen Mitteln umfassend vermessen. Seit der Entstehung vor 13,8 Milliarden Jahren dehnte sich das Universum, in dem wir leben, auf ungefähr 93 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser aus. Auf Basis der theoretischen Kenntnisse berechneten Wissenschaftler im Zusammenhang mit den bekannten Wechselwirkungen Masse und Energie des Kosmos. Experimente im Zusammenhang mit der Messung der Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums, aber auch die Bewegung von Galaxien führten zu völlig anderen Daten. Das Ergebnis ist dramatisch.
Nur fünf Prozent des sichtbaren Universums kann aufgrund bekannter Wechselwirkungen beschrieben werden. Aber etwa 95 Prozent unseres Kosmos werden mit bisherigem Wissen nicht beschrieben. Physiker bezeichenen diese unbekannte Welt mit den Begriffen Dunkle Materie und Dunkle Energie, über die bisher sehr wenig bekannt ist. Ohne die Schwerkraft der Dunklen Materie, die 26,8 Prozent beiträgt, würden Galaxien und Galaxienhaufen nicht zusammenhalten. Und die Dunkle Energie sorgt mit einem Anteil von 68,3 Prozent dafür, dass sich die Expansion des Kosmos nicht durch die Anziehungskraft der Materie verlangsamt, sondern im Gegenteil sogar beschleunigt.
Dies beschreibt die eine Flanke auf der Suche nach weiteren Energiequellen. Für diese unbekannte Welt der großen Dimensionen des Weltalls ist der Schleier des Unwissens noch zu öffnen. Aber auch die kleinen Dimensionen bieten unerforschte Phänomene. Spannend bezüglich der Suche nach neuen Energiequellen sind insbesondere die sogenannten Quantenfluktationen. Hierauf werden wir später nach einmal bei der Betrachtung einzelner Energiequellen und ihrer Anwendung eingehen.
Nun aber genug der Theorie. Lassen sie uns zur Praxis übergehen. Das nächste Kapitel widmet sich grundsätzlichen Konzepten zur Gewinnung von Nutzenergie aus Energiequellen in der Vergangenheit und in der Gegenwart insbesondere in Bezug auf den Systemwechsel. Dabei werden zuerst die heute bekannten Quellen eingeordnet. Wir versuchen auch, ein wenig den Schleier vor zukünftigen Methoden zu lüften. Lösungen zur Bereitstellung von Energie basieren vielfach auf Erfahrungen und Beobachtungen im täglichen Leben. Sie entstehen aber ebenso als Anwendung des Wissens um Fundamente aller Energiequellen.
Leimen / Heidelberg — 30. Juni 2022
Andreas Kießling, energy design