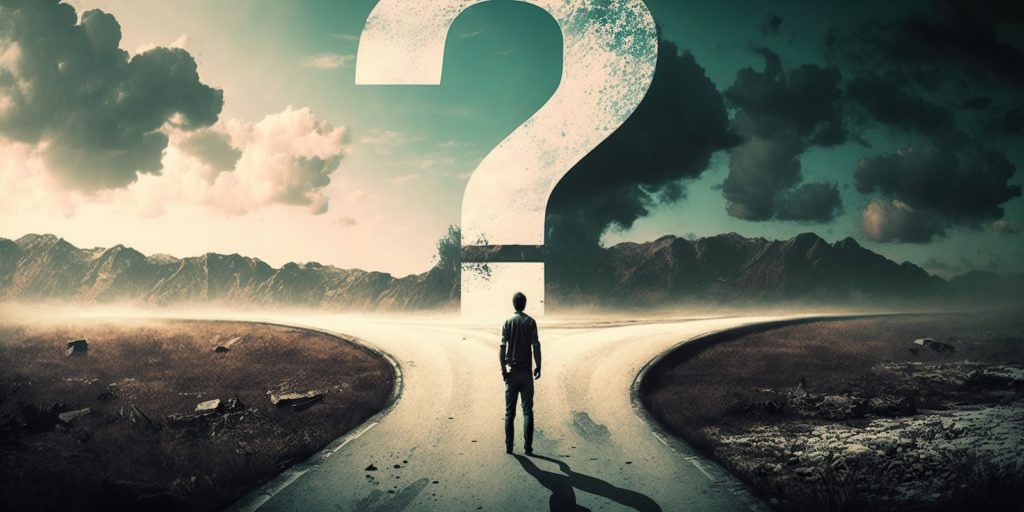Nachruf zum Öffentlichen Brief an einen Energiewende-Kritiker
Sehr geehrter Energiewende-Kritiker,
völlig legitim ist es natürlich, eine andere Meinung zu vertreten. An dieser Stelle besteht auch nicht die Absicht, ihnen die physikalische und technologische Kompetenz abzusprechen. Die Frage lautet nur, ob ihrer Diskussion als Energiewende-Kritiker eine zu schmale Weltsicht zugrunde liegt? Werden Literaturquellen und Studien vorrangig zur Unterstützung ihrer Ziele ausgewählt und treibt sie der Ehrgeiz, den eigenen Blickwinkel der gesamten Gesellschaft aufzuprägen?
Wer die eigene Meinung unter hohem Aufwand in die Gesellschaft trägt, sollte auch bereit sein, sich den Kritikern des eigenen Standpunktes zu stellen, statt sich nur mit den Jüngern der eigenen Botschaft zu umgeben. So war auch mein Versuch zu verstehen, mit ihnen in den Austausch zu treten, den sie leider ignorierten.
Das Problem mit der blinden Gefolgsschaft bei Jüngern ist, dass die Predikten des Anführers meistens nicht mehr ausreichend hinterfragt werden. Bestätigt nun dieser Kreis den Prediger regelmäßig in seiner Meinung und der Wortführer unterlässt die kritische Diskussion mit Gesprächspartnern außerhalb des Netzwerkes, folgt Blindheit bezüglich eigener Denkfehler und neuer Wege.
In anderer Weise lässt sich ihr einseitiges Engagement für Energie aus der Kernspaltung nicht mehr interpretieren.
Zwar sind ihre Zweifel nachzuvollziehen, ob allein Energie aus Sonne, Wind und Wasser den Energiebedarf der Menschheit für das nächste Jahrhundert decken kann. Hierzu zählen natürlich auch die Ziele der Menschheit zu anderen Sternen zu gelangen und die Formen der Rohstoffnutzung auf völlig neue Säulen zu stellen. Aber sie werfen den Vertretern Erneuerbarer Energien vor, eine zu enge technologische Sicht auf die Möglichkeiten der Zukunft zu haben, um eine noch verengtere Sicht selbst in ihrer sogenannten Kolumne “Die Energiefrage” anzuwenden.
Was treibt die Verteidiger der Hochrisiko-Technologie Kernspaltung?
Ihre eingerenzte Sicht auf Kernenergie bleibt unverständlich, insbesondere aus Sicht meines ursprünglichen Berufes als Kernphysiker. Wenn sie ihren persönlichen Fokus auf die Kernenergie ausrichten, warum schlagen sie sich engagiert auf die Seite der Kernspaltung, wenn doch die Kernfusion zukunftsträchtiger ist? Was treibt sie, die Gefahren der Radioaktivität zu verniedlichen, wenn eingesetzte Atombomben, weitere Atombombenversuche sowie Unglücke mit Kernkraftwerken soviel Unglück über die Menschen gebracht haben? Unter diesem Blickwinkel ist einer der Artikel in ihrer Kolumne „Die Energiefrage“ unter der Nummer 53 mit dem bezeichnenden Titel „Einsatz von Kernenergie – ein Gebot der Ethik?“ schon fast makaber. Ich zitiere Dr. Friederich:
“ Überhaupt ist die Tatsache, dass es ernste Unfälle in Kernkraftwerken gegeben hat, kein Grund, auf Kernenergie zu verzichten – nicht mehr jedenfalls, als der Untergang der Titanic ein Grund gewesen wäre, auf Schifffahrt zu verzichten, und nicht mehr, als der Bruch des Banqio-Damms in China 1975 mit über 170.000 Toten ein Grund gewesen wäre, auf Wasserkraft zu verzichten. Ingenieure, die neue Reaktoren entwerfen, haben ihre Schlüsse aus Tschernobyl und Fukushima gezogen. Sie ziehen beim Design neuer Reaktoren nicht nur Erdbeben und Tsunamis in Betracht, sondern auch mögliche Terrorakte und Flugzeugabstürze.“
Der Untergang der Titanic wird mit der Vernichtung ganzer Lebensräume im Umkreis vieler Hundert von Quadratkilometern weiträumig um Tschernobyl und Fukushima verglichen. Fassungslosigkeit mach sich breit.
Die gesamte Diskussion in der Kolumne „Die Energiefrage“ ist davongetragen, mit der Kernenergie eine Technologie hochleben und andere Technologien zur Nutzung von Sonne und Wind zu bekämpfen. Während der Herausgeber den Vertretern Erneuerbarer Energien Einseitigkeit vorwirft, lässt er selbst genau diese Technologieoffenheit vermissen. Hinzu kommt, dass er der Politik vorwirft, nicht mehr die Bürger zu vertreten und zu einer neuen „Bürgerbewegung für Kernenergie“ aufruft, aber gleichzeitig die Chancen für lokale Bürgerenergie und regionale Gestaltungsmöglichkeiten der Erneuerbaren Energien und weiterer Forschungsansätze für neue Energietechnologien völlig ignoriert.
Kernenergie ist keine Bürgerenergie!
Der Standpunkt vom Energiewende-Kritiker und Herausgeber der genannten Kolumne würde zum Themenkreis Bürgerenergie, Selbstgestaltung und Autonomie, dem Verhältnis von Subsidiarität und Globalisierung im Kontext der Energiefrage, der Demokratisierung der weltweiten Energiewirtschaft als Grundlage für wirtschaftliches Wachstum in Ländern, wo aktuell noch Milliarden Menschen der Zugang zur Elektrizität fehlt, sehr interessieren.
Welchen Sinn soll eine geforderte Bürgerbewegung für Kernenergie haben, die sie als neugegründete, europäische Bürgerbewegung unter dem Titel „Nuclear Pride Coalition“ feiern und die nur wenig Großkonzerne der Welt reicher macht, wenn wir schon eine Bewegung für Energie in der Bürgerhand haben, die die Energiefrage demokratisiert und in die Verantwortung der Mehrheit legt. Haben sie schon einmal darüber nachgedacht oder vertreten sie nur die Interessen weniger Unternehmen?
Sie zitieren Michael Shellenberger, dessen Aussagen zwar darin zu stützen sind, dass dort der Lebensstandard steigt, wo Energie günstig im Überfluss zu haben sei, dabei die Lebenserwartung, das Bildungsniveau und die allgemeine Lebensqualität zunimmt. Aber sein Engangement für die klassischen Formen der Kernenergie verspricht genau das Gegenteil und führt in die Abhängigkeit der Menschen von wenigen Unternehmen. Eine Bürgerbewegung für Kernenergie ist ein Widerspruch in sich. Bürgerbewegungen stehen für Demokratie, für Eigenverantwortung und Mitgestaltung. Bürgerbewegungen richten sich in der Regel gegen die Bevormundung von zu viel Staat, gegen Abhängigkeiten einer globalen Industrie und betonen Subsidiarität. Mit dem Engagement für große Kernkraftwerke würde eine Bürgerbewegung sich selbst ad absurdum führen.
Neue Chancen schaffen und die Nutzung vorantreiben
Wie gesagt, das Thema Kernenergie sollte klar in zwei Kategorien zerlegt werden. Während die Kernspaltung als Hochrisiko-Technologie auf den Müllhaufen der Geschicht gehört, bietet die Kernfusion neue Möglichkeiten und kann Chancen eröffnen. Hierzu lassen sich auch heiße Verfahren, die ohne den Wegbegleiter Radioaktivität auftreten, als zukünftige Grundlastkraftwerke einbeziehen.
Dazu gehören Anlagen, die nicht im thermodynamischen Gleichgewicht betrieben, sondern durch Laserimpulse befeuert werden. Hierzu zählt ein Verfahren zur Fusion von Wasserstoffkernen mit Bor unter Nutzung extremer Laserimpulse, das auf Grundlage der technologischen Fortschritte im Bereich intensiver Laser möglich wird. Die Reaktion zwischen Wasserstoff und Bor setzt keine Neutronen und damit keine Radioaktivität frei. Es werden im Rahmen dieser Fusionsreaktion ausschließlich stabile Heliumkerne gebildet.
Dazu gehört aber bei offener Sichtweise auch, die Diskussion in noch unerforschten Grenzbereichen der Physik zu ermöglichen. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung von „kalten“ Fusionsreaktionen, die die Kernfusion in jeden Haushalt tragen und der weiteren Zentralisierung der Energiefrage eine zusätzliche dezentrale Kraftwirkung entgegensetzen kann. Auch die Nutzung magnetischer Felder, die Kopplung der Gravitationskraft mit elektromagnetischen Wirkungen sowie die Quantenfluktationen des Vakuums bieten vielfältige Forschungsansätze.
Insofern bin ich mit ihnen in einem Punkt einig. Wir benötigen mehr Technologieoffenheit zur langfristigen Lösung der Energiefrage. Wir wissen nicht, was uns die Technologiezukunft des 21. Jahrhunderts noch bringen wird. Aber die alte Technologie Kernspaltung mit aller Kraft zu verteidigen und die hoffnungsvolle Entwicklung einer dezentral und demokratisch in Bürgerhand anwendbaren Energiegewinnung durch Wind und Sonne gleichzeitig zu bekämpfen, zeugt davon, dass sie ihre gepredigte Technologieoffenheit selbst nicht ernst nehmen.
Dann ergibt sich schnell die Folgerung, dass ihre Diskussion als Energiewende-Kritiker interessengetrieben geführt wird, oder?
Leimen, den 28. Oktober 2018, Dipl.-Phys. Andreas Kießling