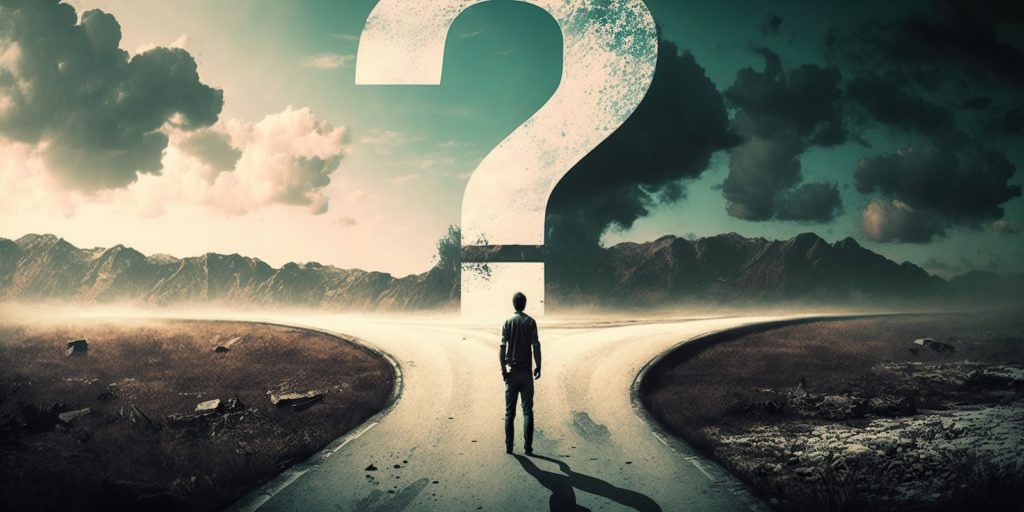Öffentlicher Brief zu Mythen und Chancen einer nachhaltigen Energiepolitik
Sehr geehrter Herr Energiewende-Kritiker,
mit diesem öffentlichen Brief soll ein Beitrag zur aufgeworfenen Diskussion um Mythen der Energiepolitik im Rahmen der Energiewende geleistet werden. Um den offenen Blick auf den hier abgegebenen kontroversen Beitrag zu ermöglichen, möchte ich zuerst betonen, dass zwar einige im Rahmen ihrer Kolumne abgegebenen Aussagen in Frage gestellt, aber gleichzeitig wichtige Denkanstöße für einen erweiterten Blick auf Energiepolitik aufgenommen werden.
Zu Beginn gebe ich das Bekenntnis ab, im Leben auch Opfer verschiedener Mythen gewesen zu sein. Dazu gehört als Ostdeutscher der frühere Glaube an die Gesellschaftsordnung, in der wir aufwuchsen. Doch wir mussten erkennen, dass Zentralismus zu mangelnder Entwicklungsfähigkeit, Starrheit und letztendlich zum Systemzusammenbruch führt. Ich werde darauf im Zusammenhang mit der Diskussion um die Vorteile eines dezentralen Energiesystems zurückkommen. Zu den Mythen gehörte auch der Glaube an die Kernenergie als billige, saubere und überall verfügbare Energieform. Dieser Glaube war der eigentliche Beweggrund, warum ich den Traumberuf des Physikers wählte. Die Diplomarbeit verteidigte ich im Juni 1986, zwei Monate nach der Katastrophe von Tschernobyl, womit ein Umdenkprozess begann. Letztendlich ist es auch ein Mythos, dass die Menschheit zu den Sternen fliegen muss. Aber wir nehmen uns dieser Herausforderung an, weil uns das Unbekannte reizt, die Suche nach dem Neuen uns zum Menschen macht und weil dies möglicherweise unser langfristiges Überleben sichert. Hier stellt sich die Frage, ob Mythen grundsätzlich mit einem behaupteten Wahrheitsgehalt verbunden sind, der bekämpft werden muss. Teilweise hinterlassen ihre Artikel unter der Überschrift „Mythen der Energiepolitik“ diesen Eindruck. Wir wissen nicht, ob der Weg zu den Sternen für die Menschheit erfolgreich ist. Aber ich denke, einig kann man sich in der Sicht sein, dass ohne den Weg zu den Sternen, die zeitliche Dauer der Existenz der Menschheit begrenzter ist, als wenn wir uns im Weltraum diversifizieren, neue Ressourcen finden und neue Entwicklungsanreize erfahren. Außerdem können Mythen anregend sein, um zu träumen, neue Wege zu suchen und neue Erfahrungen zu machen. Wenn aber der Mythos zum Dogma wird, lauert die Gefahr der Erstarrung. Bewegungslosigkeit behindert dann Entwicklung und diese Gefahr birgt sicherlich auch Energiepolitik. Eine gute Lösung bedeutet nie, dass es zukünftig nicht neue Lösungen gibt. Es gilt Offenheit zu bewahren. Bei allen nachfolgenden Kritikpunkten bezüglich ihrer negativen Beurteilungen zur Solar- und Windenergie sowie dezentraler Ansätze befördere ich gern ihre Forderung nach Offenheit für zukünftige technologische Entwicklungen, um neue Chancen zukünftigen Generationen nicht zu verbauen und den Weg zu den Sternen zu bereiten.
Im Rahmen dieser Sichtweise werde ich mich nachfolgend mit einigen ihrer Ausführungen auseinandersetzen, um dann aber auch Brücken für eine offenere Sichtweise auf Energiesysteme der Zukunft zu bauen.
Dezentrale Architektur des Energiesystems
Nachfolgende Ausführungen haben das Ziel, kritischen Sichten auf dezentrale Ansätze für das Energiesystem der Zukunft alternative Überlegungen gegenüberzustellen. Ihre Ausführungen verbreiten sie im Namen des Deutschen Arbeitgeber Verbandes e.V., der sicherlich nicht die Sicht der Mehrheit deutscher Arbeitgeberverbände sowie des Dachverbandes widerspiegelt. Bezüglich einer derartigen Vereinigung ist aber mit hoher Sicherheit, davon auszugehen, dass die Erweiterung wirtschaftlicher Chancen im Interesse einer solchen Organisation ist und insofern sich die Abwägung zwischen zentralen und dezentralen Ansätzen der Wirtschaftlichkeit als Zielrichtung widmen sollte.
Unbestritten sind die Herausforderungen bei der Gestaltung des Energiesystems sehr vielfältig und komplex, was die Suche nach einem gemeinsamen Vorgehen in der Energiepolitik schwierig gestaltet. Oft verfehlen die Diskussionen um Erneuerbare Energien und die Dezentralisierung des Energiesystems aber die wirkliche Stärke der Erneuerbaren. Bei genauer Betrachtung geht es oft nur um den Erhalt vergangener Wertschöpfungsprozesse und es werden die Möglichkeiten neuer und vielfältig erweiterter Wertschöpfung im Umfeld quasi unbegrenzt und überall vorhandener Ressourcen übersehen. Der Systemumbau bietet bei offener Sichtweise auf das gesellschaftliche Gesamtsystem höchste Chancen für neues ökonomisches Wachstum mit zusätzlichen Möglichkeiten für Unternehmen, Menschen, Kommunen und Regionen sowie für die Stärkung Deutschlands im internationalen Kontext. Diese Chancen beweisen, dass Wachstum und Schonung des natürlichen Kapitals der Erde kein Gegensatz sind.
Dabei gilt es natürlich, das europäische Verbundsystem zu sichern, da es mit seinen ausgleichenden Effekten dazu beiträgt, die Versorgungssicherheit in Europa auf einem sehr hohen Stand zu halten. Aber ein Gesamtsystem als Verbund vielfältiger dezentraler Systeme schafft einerseits Möglichkeiten der Selbstgestaltung in Kommunen und Regionen und erhöht Akzeptanz durch subsidiäres Handeln, aber wird anderseits dem auch von der EU-Kommission ausgegebenen Anspruch zur Entwicklung eines wettbewerblicheren Energiesystems gerecht.
Subsidiarität und Verbundenheit führen zum Vorschlag eines Energiesystems mit regionalen Erzeugungs‑, Speicherung- und Ausgleichmechanismen im Verbund von Strom, Gas (inklusive neuer Wasserstoffinfrastrukturen), Wärme und Mobilitätskonzepten sowie der Abstimmung zwischen regionalen Interessen, gesamtstaatlichen Anforderungen und europäischen Ansprüchen in umfassenden Verbundnetzen. Ein gemeinsames Energiesystem in Europa wird nur dann weiterhin erfolgreich sein, wenn es gelingt, die Vielfalt der wirtschaftlichen Chancen zu entwickeln, lokales und regionales Handeln zuzulassen sowie dabei den Rahmen zu schaffen, dass globales Denken für alle Akteure interessant bleibt und zur Verbundenheit führt.
Die Transformation des Energiesystems erfolgt auf dieser Basis auch in bedeutenden Maße von unten nach oben, wobei hier im förderalen System Deutschlands die Landkreise und die Bundesländer eine entscheidende Rolle spielen. Ein nur aus zentraler Sicht festgelegtes, starres System führt zu keiner Akzeptanz und verhindert Partizipation breiter Interessengruppen zu Gunsten weniger Akteure. Die Chance für neue Arbeitsplätze in Europa sowie für neue Wertschöpfung in den Regionen besteht in der Vielfalt.
Es ist also im Kern die Fragestellung zu beantworten ist, wo die Energiewende stattfindet. Mit dem breiten Engagement für die Energiewende und der damit verbundenen hohen Zustimmungsrate bei der Bevölkerung hat Deutschland die einmalige Gelegenheit, weltweit Impulsgeber für den notwendigen Umbau des Energiesystems zu sein. Mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten einer hohen Beteiligung erhöht sich auch die Diversifizierung der Energieangebote als Mittel der Versorgungssicherheit gegenüber zentralen, angreifbaren Systemen.
Zunehmend erkennen die Kommunen die Chancen regionaler Wertschöpfung und treiben die Planung und den Umbau regionaler Energiesysteme voran. Die Kommunen und Kreise erlangen damit zunehmend autonome Gestaltungsfreiheit im Planungshandeln zurück. Dezentrale Energien aktivieren neues Kapital und befördern neues ökonomisches Wirken. Dieses neue Wirken gestaltet wiederum auf neue Weise das Zusammenleben in den Städten und Regionen der Zukunft.
Quellen des Energiesystems
Die unter dem Label des Deutschen Arbeitgeber Verbandes herausgegebenen Artikel beschäftigen sich damit, sogenannte Mythen zur Energiepolitik zu offenbaren. Dabei macht sich der Eindruck breit, dass die Notwendigkeit des Ausbaus Erneuerbarer Energien bestritten wird und am bisherigen Energiesystem mit fossilen Energieträgern und Kernenergie festgehalten werden soll. Beim Versuch die dortigen Ausführungen nachzuvollziehen, fehlt mir das Verständnis für die damit verbundene Zielstellung aus dem Blickwinkel eines Arbeitgeberverbandes. Meinen ursprünglichen Beruf als Kernphysiker – spezialisiert in Kerntechnik und Kernenergetik — sowie als ehemaliger Entwickler kernphysikalischer Messtechnik erwähnte ich schon. Auf Basis dieser Herkunft kann versichert werden, dass der Bau und Betrieb von Kernkraftwerken sicherlich weniger Arbeitsplätze bereitstellt als Bau, Wartung und Energiedienstleistungen rund um erneuerbare Energieanlagen mit gleichem Energieoutput, die noch dazu in einem dezentralen System vielfältig errichtet werden. Inzwischen stellte das World Economic Forum fest, dass der sogenannte „Umkipppunkt“ bei Erneuerbaren Energien bezüglich deren Wirtschaftlichkeit erreicht ist und der weitere Ausbau weltweit als lohnendes Investment erfolgt. Auch im Bereich der fossilen Energiewirtschaft ist dies den Verantwortlichen bereits heute klar. Insofern haben soeben die großen Energieunternehmen der USA gemeinsam Präsident Trump aufgerufen, nicht aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, da sie selbst an den zukünftigen Chancen des neuen Energiesystems beteiligt sein wollen. In Deutschland schaffen Unternehmen im Umfeld Erneuerbarer Energien längst mehr Arbeitsplätze als die hoch automatisierten Kohleförderstätten und Kohlekraftwerke.
Aus dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit und der Chancen neuer Geschäftsmodelle sowie der Möglichkeiten zur Schaffung neuer Arbeitsplätze ist es also schwer nachvollziehbar, warum ein Arbeitgeberverband das Thema einer nachhaltigeren Energiewirtschaft so geringschätzt. Zu beachten ist schon, dass der Begriff Nachhaltigkeit teilweise inflationär eingesetzt wird. Im Kern bezeichnet dieses Wort das Handlungsprinzip zur Ressourcen-Nutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des jeweiligen Systems im Vordergrund steht [Seite „Nachhaltigkeit“ (2017). In: Wikipedia]. Die Definition deutet darauf hin, dass Nachhaltigkeit eher Dynamik als Statik beschreibt. Die Entwicklung der Lebensräume und damit der darin eingebetteten Energiesysteme ist ein dynamischer Prozess der Veränderung, der die Systemwandlung beinhaltet. Der Erhalt des Lebens erfordert aber auch eine gewisse Stabilität des Systems und seiner wesentlichen Eigenschaften. Zur Entwicklung des Lebens werden die Systemressourcen der jeweiligen Lebensräume benötigt. Um die notwendige Stabilität des Systems zu sichern, ist zwingend dessen Regenerationsfähigkeit zu gewährleisten, die sich auf Grundlage interner Prozessgeschwindigkeiten aber auch auf Basis des Austausches mit der externen Systemumgebung durch Zuflüsse und Abflüsse ergibt. Dieses fragile Gleichgewicht eines metastabilen Systems wurde durch die übermäßige Nutzung unserer fossilen Ressourcen sowie der natürlichen Angebote unserer Lebensräume gestört. In diesem komplexen Umfeld bewegt sich der Kern der Nachhaltigkeitsdiskussionen. Die Frage besteht darin, wie weit kann das Potential der Vergangenheit ausgeschöpft werden, um die Zukunft unter Erhalt der wesentlichen Systemeigenschaften und unter Ausnutzung der Systemregeneration zu gestalten.
Der Begriff Nachhaltigkeit ist aber ebenso bei der Beurteilung des Einsatzes nuklearer Energiequellen zu verwenden. Zwar ist spaltbares Material langfristig vorhanden. Es findet bei stabilem Betrieb eines Kernkraftwerkes auch kein Ausstoß klimaschädlicher Gase statt. Das inakzeptable Restrisiko für eine radioaktive Katastrophe und die Probleme zur Beherrschung einer stabilen Lagerung von radioaktiven Reststoffen über Jahrhunderttausende widersprechen aber den Nachhaltigkeitsprinzipien zum Erhalt wesentlicher Eigenschaften und der natürlichen Regenerationsfähigkeit des Systems Erde. Hier stellt sich die Frage, wie weit das zukünftige System belastet wird und damit vorab ausgeschöpft werden kann, um wichtige Systemeigenschaften auch in der Zukunft vorzufinden.
Insofern ist die Nutzung fossiler Energieträger nicht per se in die Kategorie nicht nachhaltiger Prozesse einzuordnen. Menschliche Energiegewinnung basierte lange auf der Anwendung eigener Muskelkraft oder der von Tieren, um Bewegungsenergie zu erhalten. Die Muskelkraft beruht wiederum auf der in Pflanzen und Tieren gespeicherten chemischen Energie, die mit der Nahrung aufgenommen wird. Die Energiegewinnung aus der Nahrungskette ist dann solange nachhaltig, wie nicht mehr Leben genommen wird als neu entstehen kann.
Ebenso war die Gewinnung von Wärme für den menschlichen Bedarf beim Heizen und Kochen unter Nutzung organischer, pflanzlicher Rohstoffe, beispielsweise durch die Nutzung von Holz, solange nachhaltig, wie weniger Holz verbraucht wurde als zur gleichen Zeit nachwachsen konnte. Gleichzeitig bewirkte die ausgeglichene Nutzung zwischen Abbau und neuem Wachstum, dass der Kohlendioxid-Anteil in der Luft konstant blieb. Bei einer geringen Bevölkerungszahl auf der Erde konnte dies gewährleistet werden. Unter den Bedingungen des massiven Bevölkerungswachstums zeigt das heutige Schwinden von Waldflächen in Ostasien und in Südamerika nun, dass diese Form der Umwandlung von Energiearten nicht mehr nachhaltig ist. Heute nutzen wir die Ressourcen schneller als sie nachwachsen können und geben mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre ab als neu gebunden wird. Die Eigenschaften des Systems Erde ändern sich damit massiv. Überlebensfähige Gesellschaften der Vergangenheit bewahrten die Ressourcen ihrer Umwelt. Bei Raubbau an den Ressourcen im Sinne nicht nachhaltiger Verwendung verschwand Schritt für Schritt die Lebensgrundlage der entsprechenden Gesellschaft und so endete die jeweilige erfolgreiche Entwicklung.
Doch auch schon vor der Periode der Industrialisierung mit intensiver Nutzung fossiler Energieträger nutzte die Menschheit Erneuerbare Energien. Schiffe fuhren mit Windkraft. Seit 2000 vor Christus wird Wasserenergie zum Antrieb mechanischer Einrichtungen genutzt. In der Mehlmühle arbeitete der Müller mit Windkraft. Schon 1500 vor Christus haben die Ägypter begonnen, Sonnenenergie zu nutzen. Zur Zeit des Pharaos Echnaton wurden mit Sonnenenergie die Tore eines Tempels morgens geöffnet und abends geschlossen, indem Sonnenkollektoren Wasser erwärmten und die mechanische Energie aus der Ausdehnung von Wasser gewonnen wurde. Vor der ersten industriellen Revolution bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts wurde die zur Produktion benötigte Energie vorrangig durch Wind- und Wasserkraft gewonnen. Schon 1790 erbrachten in Europa eine halbe Million Kleinwasserräder eine Leistung von ungefähr 1,65 Gigawatt Leistung.
Industrialisierung und der steil steigende Bedarf an Energie beförderten auf Basis der damals leicht erschließbaren Quellen Kohle und Öl sowie der Einführung der Nutzung des Wechselstroms zuerst das zentrale Energiesystem. Diese Veränderung während der ersten und zweiten industriellen Revolution beschleunigte die menschliche Entwicklung, reduzierte aber gleichzeitig die Innovationsfähigkeit der Energiewirtschaft. Die Kohle‑, Gas- und Erdölnutzung machte über ein Jahrhundert alle Überlegungen bezüglich neuer Energieträger überflüssig. Der Energiehunger der Menschheit ab Mitte des 20. Jahrhunderts kostete das fossile Angebot extrem aus. Zusätzlich eroberte die Kernenergie ab den 1950-er Jahren die Welt. Das Nachdenken über andere Wege erschien bis in die 1970-er Jahre überflüssig.
Heute verändern diese Wege aber entscheidend die Systemeigenschaften der Erde, wobei noch dazu dieses Energiesystem nicht für alle Menschen bereitsteht. Zwischen eins und zwei Milliarden Menschen besitzen keinen Zugriff auf Strom. Erneuerbare Energien und Dezentralität setzten auch hier an, benötigten dabei aber eine längere Unterstützungsphase. Aber gerade nun, da sich Wirtschaftlichkeit entfaltet und der Systemwandel weltweit bevorsteht, greifen die Ausführungen zu Mythen der Energiepolitik unter dem Banner eines Arbeitgeberverbandes die Interessen der gestrigen Energiewirtschaft auf und vergessen die Chancen des Systemwandels.
Effektivität und Effizienz
Richtig ist, dass die deutsche Energiepolitik zu lange von der Konzentration auf den Umbau des Stromsystems geprägt war. Wärme macht rund 50 Prozent am Endenergieverbrauch aus. Weitere 28 Prozent des gesamten Endenergiebedarfes werden im Verkehrssektor eingesetzt. Zusätzlich entstehen aufgrund der hohen Schwankungsbreite des Angebotes an Erneuerbarer Energie mit den Quellen Wind und Sonne hohe Bedarfe an Speicherkapazitäten. Um unter diesen Bedingungen den Umbau zum erneuerbaren Energiesystem in wenigen Jahrzehnten zu vollziehen, ergeben sich die resultierenden gesellschaftlichen Ziele zur Erhöhung der Energieeffizienz.
Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen uns, dass Wachstum immer mit der Steigerung des Energieverbrauches verbunden war. Heute zeigen sich erste Indizien, dass Wachstum auch mit weniger Ressourceneinsatz erzielt werden kann. Trotzdem lassen sich aufgrund der beschleunigten Entwicklung neuer Technologien nur sehr schwer Zukunftsprognosen abgeben. Neue Technologien wie Nano- und Biotechnologien, neue Materialien, 3D-Druck, usw. generieren Wachstum ohne Steigerung des Energieverbrauches. Nicht auszuschließen sind Technologien mit deutlich höheren Energieeinsatz. Aber gerade im Hinblick auf die Unsicherheit der Prognostizierung des zukünftigen Energiebedarfes sollte im Umfeld eines noch nicht vollständig nachhaltigen Energiesystems der Energieeffizienzsteigerung hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden. Aus Sicht eines Arbeitgeberverbandes ist dabei in Betracht zu ziehen, das Fortschritte bei energieeffizienten Technologien neue Chancen für Unternehmen generieren.
Mit dieser Darstellung ist zu erkennen, dass die Verbindung von Erneuerbaren Energien zur Gestaltung nachhaltiger Energiekreisläufe und Energieeffizienz nicht immer zwingend ist, da eventuell ein höherer Durchsatz von Energie in Kreisläufen auf nachhaltige Weise erzielt werden kann und damit Effizienz keine Rolle spielt. Unter Betrachtung der globalen Herausforderung, den Weg der fossilen Energiegewinnung in diesem Jahrhundert zu verlassen, den wachsenden Energiehunger einer sich vergrößernden Menschheit im Prozess der Urbanisierung und Modernisierung zu befriedigen und gleichzeitig die Konversion des Energiesystems zu Erneuerbaren Energien erfolgreich zu gestalten, wird aber schnell klar, dass die deutliche Erhöhung der Energieeffizienz ein unverzichtbares Begleitmittel im globalen Maßstab der Systementwicklung bleibt.
Bei lokaler oder regionaler Betrachtung geschlossener Energiekreisläufe, die teilweise schon in naher Zukunft auf 100 Prozent Erneuerbaren Energien basieren können, ergeben sich aber auch andere Aspekte. Gebäude, Gebäudekomplexe oder Städte entwickeln sich zu lokalen Lebensräumen mit Überschüssen an Erneuerbaren Energien zu bestimmten Zeiten, die über Energieangebote in Beziehung zu ihrer Umwelt treten können. Diese Beziehungen eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen. Insofern ist möglichweise zusätzlich zur Beurteilung von Effizienz die Bewertung der Effektivität für die gesamte Volkswirtschaft noch viel wichtiger.
Effektivität ist die Wirksamkeit im Sinne der Erreichung angestrebter Ziele als Verhältnis von Wirkungen (Outcome) bezogen auf die Ziele, wobei die Leistungen (Output) eines Systems die Wirkung bestimmen. Effektivität bestimmt die Genauigkeit und Vollständigkeit, mit der Benutzer ein Ziel erreichen. Der Grad der Effektivität beantwortet die Frage, ob die richtigen Dinge bezogen auf das Ziel getan werden [Online Verwaltungslexikon (2016)]. Die gesellschaftlichen Ziele beim Umbau des Energiesystems sind Umweltverträglichkeit, Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und breite Partizipation an der Wertschöpfung. Die Effektivität der Energieverteilung bewertet damit das Verhältnis der quantitativen Veränderungen dieser vier Parameter (Wirkungen) bezogen auf die Zielstellungen. Dezentrale Energien bieten die Chance, Wertschöpfungspotentiale für Kommunen, Regionen, Bürger und neue Unternehmen und damit gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtspotentiale zu heben [Prognos (2016)]. Das Heben dieser Potentiale durch Partizipation am dezentralen Energiesystem gegenüber der zentralen Erzeugung mit einem verbundenen System aus Subsystemen (Energiezellen) mit individueller Verantwortlichkeit und autonomen Entscheidungen ist damit ein Bewertungskriterium für Effektivität.
Der Bewertung der gesellschaftlichen Wirkung folgt nun mit der Effizienz die Bewertung der Leistung. Effizienz ist das Verhältnis von Leistungen (Output) zu Aufwänden/Ressourcen und/oder anderen Nachteilen/Opfern (Input) mit dem Benutzer ein bestimmtes Ziel erreichen. Es geht also um Mittel und Wege zur Erreichung der Wirkungen. Der Grad der Effizienz im Unterschied zur Effektivität beantwortet die Frage, ob die Dinge richtig getan werden. Dabei gilt, Effizienz ist wichtig, aber die falschen Dinge effizient zu tun bleibt Verschwendung. Primär sind die Ziele und Zwecke sowie der Grad der Erreichung (Effektivität) und in der Folge die Mittel und Wege sowie ihr Einsatz (Effizienz) zu bewerten [Online Verwaltungslexikon (2016)].
Auf Basis der effektiven Gestaltung des Energiesystems — dezentraler Ansatz mit Regeln zur Verbundenheit — sind effiziente Systeme zu gestalten, um Energiekosten zu senken und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die politischen Effizienzziele zum Energieeinsatz können nur in kombinierter Betrachtung aller Endenergien erreicht werden. Der Verbrauch an Endenergie bezüglich Elektrizität und Wärme findet bis zu 50 % in den Gebäuden statt. Die Erschließung von Effizienzpotentialen in den Bereichen Elektrizität, Wärme und Kühlung/Belüftung erfordert ein integriertes und automatisiertes Energiemanagement. Dafür werden vielfältige Dienste im Umfeld von Verbrauchs- und Erzeugungsprognosen, Betriebsfahrpläne sowie auch Wettervorhersagen benötigt, was wiederum Chancen für unternehmerisches Handeln bietet.
Zukunftsblick
Mit Recht kann eine teilweise überzogene Technologiekritik in Deutschland kritisiert werden. Damit ist hier aber nicht die Kritik an der Nutzung der Kernenergie gemeint. So verlockend diese Technologie in den 50-er Jahren erschien und mich persönlich auch zum Studium der Kernphysik bewegte, so notwendig ist heute der Verzicht auf deren Nutzung. Von Anhängern dieser Energiequelle wird oft behauptet, dass Kernenergie in geringerem Maße als Erneuerbare Energie finanziell zum Wachstum gefördert werden musste. Studien mit anderen Ergebnissen werden handwerkliche Fehler unterstellt. Dabei wird in der Regel vollständig unterschlagen, dass hohe Positionen zukünftiger Kosten sowie der Risiken von der Gesellschaft getragen werden, ohne in Vergleichsrechnungen einzugehen. Kernkraftwerksbetreiber sind in Europa mit maximal 1 Milliarde Euro gegen den Super-Gau versichert, den wir in Tschernobyl und Fukushima erlebten. Die gesellschaftlichen Kosten nach einem derartigen Unfall in Europa werden in der Größenordnung von über 100 Milliarden Euro geschätzt. Die Endlagerung der Uran-Brennelemente mit einer Lagerzeit, die die Zeitdauer der Entwicklung der menschlichen Zivilisation überschreitet, ist immer noch ungeklärt. Die Kosten der Endlagerung trägt die Gesellschaft. Die geschätzten Kosten zum Rückbau von überalterten Kernkraftwerksblöcken werden regelmäßig nach oben korrigiert und betragen inzwischen mehrere Milliarden Euro pro Block. Erste Erfahrungen gibt es in Deutschland mit dem Rückbau des Kraftwerkes in Greifswald. Auch in Frankreich, wo sich mehrere überalterte Kraftwerksblöcke befinden, macht man sich zunehmend Sorgen bezüglich der exorbitanten Kosten zukünftig notwendiger Rückbauten. Weiterhin werden zunehmend im Bereich der Kernenergie neue Kraftwerksbauten mit höheren Förderungen ausgestattet. Unrühmliches Beispiel ist der Bau des Kernkraftwerkes Hinkley Point in England, dessen Kosten aus dem Ruder laufen. Dabei werden dem Kraftwerksbetreiber massive staatliche Förderungen zugesichert, z. B. Kreditgarantien in Höhe von mehr als 20 Milliarden Euro zur Absicherung der Baukosten. Weiterhin wird ein mit elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) vergleichsweise hoher Abnahmepreis für den in Hinkley Point C produzierten Atomstrom garantiert — dies über 35 Jahre, plus Inflationsausgleich. Konservativ hochgerechnet mit einer Inflationsrate von zwei Prozent macht das eine Vergütung von 22 Cent pro kWh im letzten Förderjahr. Eine große Photovoltaik-Anlage erhält in Deutschland über das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahre 2016 eine Vergütung von rund acht Cent pro kWh – 20 Jahre lang, ohne Inflationsausgleich [Wolk, Constanze (2016)]. Von der auch seit Jahrzehnten anhaltenden Förderung der Arbeitsplätze beim Abbau der Steinkohle im Ruhrgebiet soll hier gar nicht gesprochen werden. Diese Kosten erscheinen aber im Gegensatz zur EEG-Umlage auf keiner Stromrechnung. Die Diskussion um die Förderung der erneuerbaren Energien besitzt also eine völlige Schieflage zugunsten fossiler Energien und der Kernenergie.
Warum fällt es uns eigentlich so schwer, unseren Blick als Hochtechnologieland auf die Chancen neuer Technologien zu richten?
Sicherlich sind erneuerbare Energietechnologien nicht automatisch in jeder Hinsicht nachhaltig. Beispielsweise werden für Solaranlagen und Batterien wertvolle und seltene Rohstoffe eingesetzt. Nachdem Förderung und Wachstum der Solartechnik bald auf zwanzig Jahre Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, ist das Recycling alter Anlagen immer noch eine Herausforderung. Der Anblick klassischer Solarmodule auf den Dächern und die Windanlagen in den Landschaften erfreuen ebenso nicht das Herz jedes Architekten und Landschaftsgestalters. Unabhängig von der Tatsache, wie verletzt Landschaften in den Kohle- und Erdölgebieten sind oder wie große konventionelle Kraftwerksblöcke in der Landschaft wirken, steht die Frage, ob wir weiter nur Kritik an neuen Technologien üben wollen oder Anstrengungen unternehmen, um bessere Lösungen zu finden. Elon Musk – der Gründer von Tesla und SolarCity – hat sich dieser Herausforderung angenommen und Dachziegel geschaffen, die wie die natürliche Dachbedeckung aussehen, aber als Solaranlage wirken. Zukünftig werden auch Häuserwände und Fenster Solarenergie umwandeln.
Es ist auch richtig, dass wir inzwischen wiederum auf bestimmte Lösungen fokussiert sind. Wir beschäftigen uns intensiv mit Windenergie, Solarenergie, Bioenergie, Geothermie und Wasserenergie sowie forschen auch an der heißen Kernfusion. Unsere Umwelt bietet aber weitere Energiequellen, die wir aktuell übersehen und denen sich nur wenige Menschen widmen. Physiker kennen hier vielfältige Ansätze, auf die hier nicht eingegangen werden soll. Wichtig ist nur, dass wir uns den Blick auf neue Chancen erhalten und neue Technologien nicht zu schnell in das Reich der Mythen einordnen, weil die Vertreter etablierter Technologien um ihre Pfründe bangen.
Gemeinsame Anstrengungen für die Zukunft und ein offener Blick nützen der Gesellschaft in ihrer Vielfalt und insbesondere den Unternehmen beim Ergreifen neuer Wertschöpfungschancen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze mehr, als das Verteidigen alter Stellungen. Im letzteren Fall mag man national eventuell siegreich sein, aber international den Anschluss verlieren, womit die Marke „Made in Germany“ gefährdet wäre.
Also machen wir uns doch zu den Sternen auf, um noch einmal das Eingangsthema aufzunehmen. Auch dazu benötigen wir neue Energiequellen, denn mit Kohle oder irgendeiner anderen Art von chemischer Energie werden wir die Raumschiffe sicherlich nicht antreiben. Selbst Kernenergie wird uns nicht helfen, die nächsten Sterne in überschaubarer Zeit zu erreichen.
Nachruf zum nicht beantworteten Brief
Literatur
Online Verwaltungslexikon (2016) Effektivität, Effizienz. http://www.olev.de/e/effekt.htm (Abgerufen: 15.11.2016)
Prognos (2016). Dezentralität und zellulare Optimierung – Auswirkungen auf den Netzausbaubedarf. Studie im Auftrag der N‑ERGIE Aktiengesellschaft. Prognos, Energie Campus Nürnberg, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Berlin und Nürnberg. 07.10.2016
Seite „Nachhaltigkeit“ (2017). In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. URL: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Nachhaltigkeit&oldid=129064313 (Abgerufen: 08.05.2017)
Wolk, Constanze (2016). Hintergrund: Hinkley Point C. Energiewende-Magazin. Schönau. Ausgabe 20.06.2016. https://www.ews-schoenau.de/energiewende-magazin/zur-sache/hintergruende-zu-hinkley-point‑c/ (Abgerufen: 09.05.2017)
Kemfert, Claudia. (2013): Kampf um Strom — Mythen, Macht und Monopole. Rowohlt Verlag GmbH. 01/2013, 7. Auflage. ISBN-13: 978–3867742573
Lovins, Amory B. (1978): Sanfte Energie. Das Programm für die energie- und industriepolitische Umrüstung unserer Gesellschaft. Rowohlt Verlag GmbH. 10/1978. ISBN-13: 978–3498038199