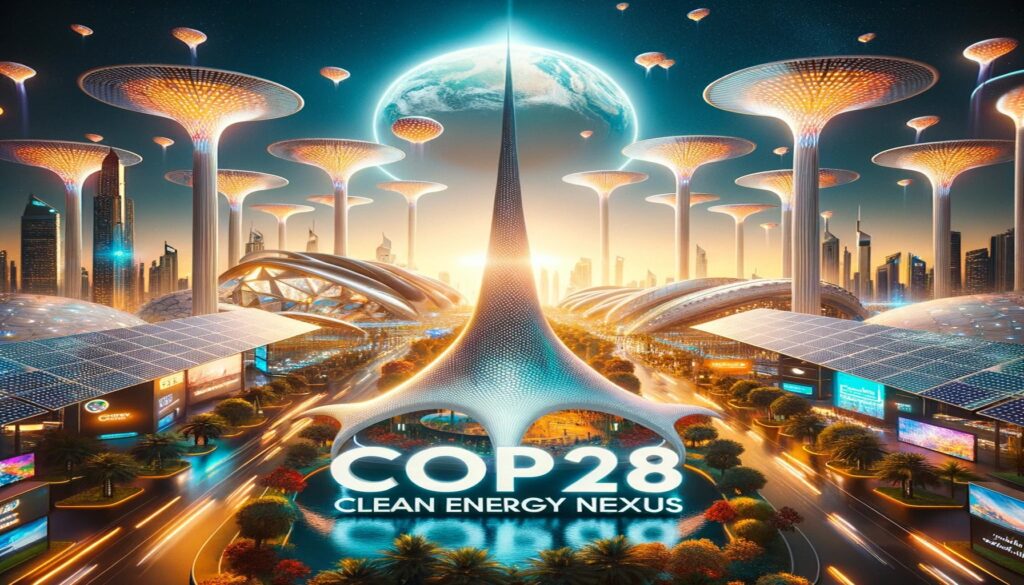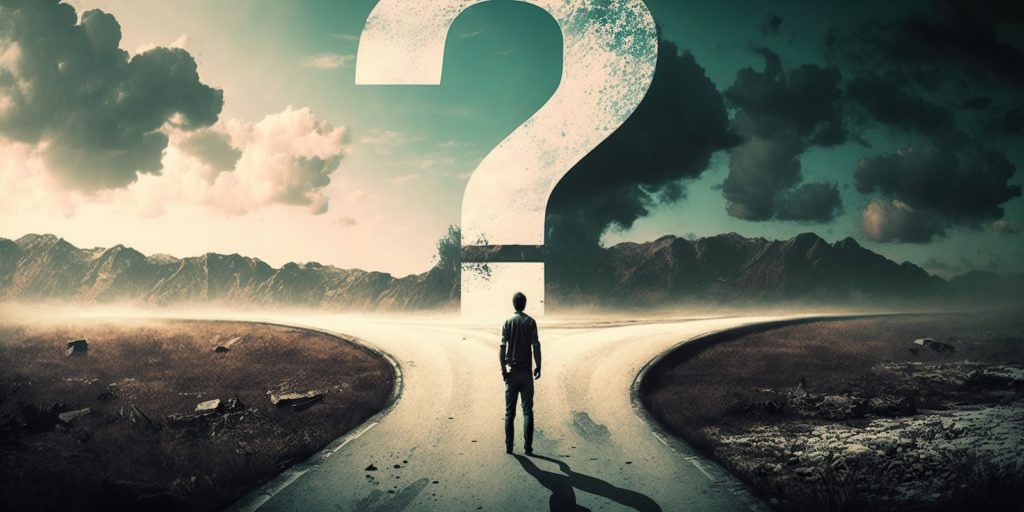Inhaltsverzeichnis
- Vorwort — Dampfmaschine im Cyber War
- Zusammenfassung — Innovationsimpulse statt Detailregulierung
- Empfehlungen zur EEG- und EnWG-Novelle — Autonomie hinter dem Netzanschluss
- Treiber der Energiewende
- Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit — Gestaltungsebenen wirtschaftlicher Entwicklung
- Eigenversorgung und Energiegemeinschaften
- Empfehlungen für die Schnittstelle zum Prosumenten
- C/sells-Position zum Stufenmodell des BMWI zur Weiterentwicklung von Standards für die Digitalisierung der Energiewende
- Technische Detailregulierung im EEG unter Blickwinkel der Abgrenzung von Rechtssystem, normativer Basis und Innovation
- Lab Hybrid — Digitaler Netzanschluss und autonomes Energiemanagement — Blaupause für Novellierung EnWG und EEG
Gestaltungsebenen wirtschaftlicher Entwicklung
„Ein Standard ist die schönste und edelste Form, eine Blaupause zu entwickeln“ Markus Gräbig
Standards entstehen nicht durch staatliche Detailregulierung, sondern durch internationale Zusammenarbeit in der Wirtschaft
Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit
Regelkreise
Auf die Komplexität der menschlichen Gesellschaft wurde im letzten Kapitel hingewiesen. Aber die Komplexität wächst aufgrund der zunehmenden Anzahl der Gesellschaftsmitglieder und der sozialen, digitalen Vernetzung sowie durch neue Organisationsformen weiter. Zur Stabilitätssicherung in diesem komplexen Umfeld werden gemeinsame Regeln benötigt. Individuelle Freiheit sowie Nutzen der Gemeinschaft sind dabei immer wieder miteinander abzuwägen. Bei vollständiger, individueller Freiheit ohne Regeln droht die Gesellschaft in Anarchie abzugleiten. Bei einem Übermaß an Regeln verliert die Gesellschaft ihre Flexibilität und kann in einen erstarrten Zustand geraten. Dies legt letztendlich den Keim des zukünftigen Misserfolges.
Letztendlich lässt sich die Gesellschaft als ein System betrachten, in dem Regelkreise auf verschiedenen Handlungsebenen ihre Funktionen und Entwicklung sicherstellen. Insofern sind die Regelkreise, ihr Zusammenwirken und ihre Grenzen zu betrachten.
Folgendes Modell mit drei Ebenen zusammenwirkender Regelkreise und verschiedenen Zeithorizonten soll in den weiteren Betrachtungen verwendet werden.
Rechtssystem
Das Rechtssystem entsteht durch politische Willensbildungsprozesse in verschiedenen Strukturen lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Hoheit. Dabei sind Gesetzgebungsprozesse von der Entstehung, der Umsetzung bis zur Prüfung ihres Wirkens von langen, über Jahrzehnte reichenden Zeitkonstanten geprägt.
Normative Basis
Die Konkretisierung des gesellschaftlichen Zusammenwirkens erfolgt durch die gemeinsame normative Basis als unterstützender Regelkreis. Die Aufgabe besteht darin, sowohl die Umsetzung politischer Richtungsvorgaben und gesetzlicher Anliegen als auch die notwendige Effektivität und Effizienz des sozialen und wirtschaftlichen Zusammenwirkens zu sichern. Die Zeitkonstanten sind hierbei kürzer. Sie liegen aber im Bereich technischer Standards immer noch in der Größenordnung von 5 bis 10 Jahren.
Innovation
Innovationen zur Erneuerung gesellschaftlicher, inklusive wirtschaftlicher Lösungen, sichern die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Sie basieren auf der Vielfalt und Kreativität menschlichen Denkens. Innovationsfähigkeit bedarf eines hohen Freiheitsgrades mit möglichst minimalen Einschränkungen. Im internationalen Wettbewerb sind Regelungsprozesse zur Beförderung von Innovationen auf eine hohe Geschwindigkeit im Rahmen des überlagernden Rechtssystems und der jeweils verabredeten normativen Basis auszurichten.
Abgrenzung von Rechtssystem und normativer Basis
Die Anwendung der drei Regelkreise verdeutlicht aber auch die Schwierigkeit ihrer Abgrenzung. Unterschiede im kulturellen und nationalen Kontext führen sicherlich zu unterschiedlichen Antworten. Auf europäischer Ebene wird diese Fragestellung im Kontext eines funktionierenden europäischen Binnenmarktes sowie bezüglich der Themen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz behandelt.
Eine normative Basis benötigt nicht zwingend eine zugehörige Grundlage im Rechtssystem. Die gemeinsame Regelung der Rastergröße von Küchengeräten macht Sinn, um auf einem gemeinsamen Markt unterschiedlicher Küchenmöbelhersteller wirtschaftlich unterschiedliche Gerätekombinationen herstellen zu können. Der Bedarf an einer Rechtsgrundlage ist im Beispiel nicht zu erkennen. Aber rechtliche Regeln für die Installation eines Stromanschlusses am Wohngebäude erscheinen sinnvoll, um den gesundheitlichen Schutz im Rechtssystem zu verankern. Zur Umsetzung wird eine technische, normative Basis benötigt. Die gegenüber der Gestaltung des Rechtssystems höhere technische Entwicklungsgeschwindigkeit macht es sinnvoll, die Gestaltung der normativen Basis in einer gesonderten Ebene zu entkoppeln. Die Zusammenführung von Rechtssystem und normativer Basis auf einer Gestaltungsebene kann aufgrund der längerfristigen Zeitkonstante im Rechtssystem zum Verlust potentieller technischer Entwicklungsgeschwindigkeit führen.
Aber auch bei der Trennung in zwei Ebenen lassen sich zwei Handlungsansätze abgrenzen, die die Ebenen in unterschiedlichem Maße verschränken.
Der erste Ansatz verfolgt die ausschließliche Festlegung von Zielrichtungen und Anforderungen im Rechtssystem. Dies steht in Verbindung mit der Spezifikation von Maßnahmen durch Fachexperten in entsprechenden Verbänden und Organisationen sowie mit der zugehörigen Prüfung der Konformität zu den Anforderungen. Daraus folgt im Rechtssystem die Vermutungswirkung der korrekten Umsetzung zugehöriger Anforderungen durch die Wirtschaft im Rahmen der normativen Basis.
Der zweite Ansatz verfolgt zusätzlich zur Festlegung von Anforderungen die Übernahme der Koordinationshoheit durch das Rechtssystem bei der Gestaltung der normativen Basis. Dabei erfolgt die gezielte Einbeziehung anderer Interessenträger. Die Gestaltung der normativen Basis wird dann in der Regel mit einem Zertifizierungsprozess der Lösungen im Rechtssystem verbunden.
Europäische Empfehlung zum Ansatz 1
Die EU beabsichtigt, dass Rechtssystem bezüglich der neuen Herausforderungen zur Digitalisierung und zur künstlichen Intelligenz anzupassen, was ebenso das intelligente Energiesystem betrifft. Zur Ausgestaltung wird die Bedeutung der Normung sowie dazu der europäisch harmonisierten Normen hervorgehoben. Diesem Thema wird sich auch der ab 2021 neu gewählte CENELEC-Präsident Wolfgang Niedziella widmen. Der gemeinsame Dialog der europäischen Normung mit der Europäischen Kommission soll wieder aufgenommen werden.
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat und den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (11/2018) zum Thema „Harmonisierte Normen: Verbesserte Transparenz und Rechtssicherheit für einen uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarkt“.
Insbesondere wird der Normung eine wichtige Rolle zur Beseitigung technischer Handelshemmnisse zugeordnet.
„Normen tragen dazu bei, dass komplementäre Produkte und Dienstleistungen interoperabel sind, sie erleichtern die Einführung innovativer Produkte und schaffen letztlich das Vertrauen der europäischen Verbraucher in die Qualität der in der Union angebotenen Produkte und Dienstleistungen” (Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit). [EU Mitteilung 11/2018]
Hervorgehoben wird die Schlüsselrolle der Normung bei der Beförderung des Innovationstempos bezüglich neuer technologischer Entwicklungen, der Digitalisierung und weiterer wirtschaftlicher Trends sowie der Zukunftsfähigkeit des Binnenmarktes. Dies betrifft beispielsweise die Themen Internet der Dinge, Big Data, fortgeschrittene Fertigung, Robotik, 3D-Druck, Blockchain-Technologien und künstliche Intelligenz. Dabei wird auch der Ersatz widersprechender nationaler durch europäische Normen zum Erhalt der globalen Wettbewerbsfähigkeit befürwortet.
Das europäische Normungssystem basiert auf einer öffentlich-privaten Partnerschaft, die die Gestaltung des Rechtssystems und der normativen Basis deutlich trennt. Gleichzeitig können im Rechtssystem Anforderungen an die Normung definiert werden. Auf Basis von Ersuchen der Kommission als Rechtsträger werden dann für entsprechende Anforderungen über private Organisationen Lösungen durch die im Konsensprozess erfolgende Normung spezifiziert. Nachfolgend erfolgt die Prüfung der Anwendbarkeit der Ergebnisse durch den Rechtsträger.
Europäisches Vorgehen am Beispiel Künstliche Intelligenz
In den nachfolgenden beiden Abschnitten werden mögliche Vorgehensweisen entsprechend den genannten zwei Ansätzen zur Regelsetzung beschrieben. Hierbei wird als Beispiel das europäische Vorgehen in Bezug auf die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz bewertet.
Die Digitalisierung verändert zunehmend das Wirtschafts- und Sozialleben. Es stellt sich die Frage, ob wir auf diesen rapiden und komplexen gesellschaftlichen Wandel ethisch gut vorbereitet sind.
Neue rote Linien werden definiert, wie zum Beispiel:
- das Entstehen einer selbstoptimierten, nicht mehr kontrollierbaren künstlichen Superintelligenz,
- die Schaffung eines erlebens- und leidensfähigen künstlichen Bewusstseins,
- das Entstehen autonomer, moralischer Agenten, die unabhängig vom Menschen ethische Überlegungen anstellen und danach autonom handeln.
Im nationalen Umfeld sind diese komplexen Themen nicht mehr umfänglich zu gestalten.
Grundlage der weiteren Festlegung der Rahmenbedingungen zur künstlichen Intelligenz in Europa, insbesondere der ethischen Regeln, ist eine umfassende interdisziplinäre Diskussion mit Experten von Soziologie, IKT und Philosophie. Eine Bewertung soll an dieser Stelle nicht erfolgen. Stattdessen wird der Fokus in den nächsten Abschnitten auf die Gefahren einer zu engen Verbindung der Gestaltung von Rechtssystem und normativer Basis gerichtet.
Folgende Quellen vertiefen die Thematik inhaltlich:
- EU-Richtlinien für vertrauenswürdige KI 2019 [EU Report. (04/2019), mit Expertenkonsultation]
- EU-Weißbuch Künstliche Intelligenz 2020 [EU Weißbuch. (02/2019), ohne Expertenkonsultation]
- Stellungnahme zum EU-Weißbuch auf der Webseite zur Nationalen KI-Strategie der Bundesregierung 2020 [BR COM (2020) 65 final]
Ein Kritikpunkt soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden. Sowohl das Weißbuch der EU als auch die Stellungnahme der Bundesregierung wurden ohne Expertenkonsultation erstellt. Die Dokumente entstanden in den Strukturen des Rechtssystems unter Einbeziehung festgelegter Interessenvertreter. Aber gerade die Diskussion im politischen Rahmen des Rechtssystems benötigt einen breiten Willensbildungsprozess.
Begrenzung der Komplexität durch Autonomie von Handlungsebenen
Ein durch Politik vollständig koordinierter Prozess zur Regelsetzung bezüglich Leitlinien, Rechtsrahmen, normativer Basis für die Technik sowie Innovationen kann diesen Herausforderungen nicht gerecht werden. Die resultierende Überbürokratisierung minimiert Flexibilität und Handlungsfähigkeit der Gesellschaft.
Dagegen hat sich ein Vorgehen auf verschiedenen Handlungsebenen mit definierten Schnittstellen in der Praxis bewährt. Die Zuordnung der Ebenen erfolgt am obigen Beispiel.
Auf der Ebene des Rechtssystems entstehen gesellschaftliche Leitlinien im politischen Diskussionsprozess unter Einbeziehung von Experten. Dazu gehören die europäischen Richtlinien für vertrauenswürdige, künstliche Intelligenz [EU Report. (04/2019)].
Die definierten Ziele sollen im globalen Wettbewerb effektiv bezüglich Zielerreichung und effektiv bezüglich eingesetzter Mittel erreicht werden. Die Navigation auf diesem Wege übernehmen Regelkreise mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Dies betrifft im Rechtssystem sowohl die Regelsetzung als auch die Schaffung eines befördernden Rahmens, wozu das EU-Weißbuch Künstliche Intelligenz einleitet.
Einerseits wird bei der Ausgestaltung des Rechtsrahmens zu entscheiden sein, welche rechtlichen Anforderungen, basierend auf politischen Leitlinien, auferlegt werden sollen.
Anderseits kann ein befördernder Rahmen durch Erleichterungen zur Einrichtung von Exzellenz- und Testzentren entstehen. Dazu gehört auch die Begründung einer neuen öffentlich-privaten Partnerschaft. Als Teil dieser Partnerschaft wird im Weißbuch ebenso die Bedeutung von Normen und Standards sowie zugehöriger Organisationen hervorgehoben. Dies schafft die Schnittstelle zum Regelkreis der normativen Basis.
Normen entstehen im internationalen Rahmen – bei Bedarf auch europäisch — im Konsensprozess interessierter Experten beliebiger Organisationen. Breit anerkannte Normen sind die erfolgreichen Normen. Eine Koordination normativer Prozesse durch den Rechtsträger im Rahmen gesonderter Gremien umfasst zwar im Ergebnis eventuell einen Mehrheitsstandpunkt, der aber durch das Wirken eines verengten Kreises entsteht.
Schlussendlich kann die Konformität der Innovationen zum Rechtsrahmen und zur angeforderten normativen Basis durch private Organisationen geprüft werden.
Die Komplexität des Themas sowie der abzugrenzenden Handlungsebenen erfordert eine europäische Governance-Struktur statt zersplitterter nationaler Sonderwege.
Nationale Antworten in Deutschland
Die Stellungnahme der Bundesregierung zum EU-Weißbuch auf Basis der Nationalen KI-Strategie folgert: „Schließlich können Normung und Standardisierung zur Beschleunigung von Entwicklungsprozessen, zur Rechtssicherheit für Unternehmen und zur weiteren Vertrauensbildung der Menschen in die Technologie beitragen.“ [BR COM (2020) 65 final]
Hierbei unterstützt die Bundesregierung die Anwendung existierender Verfahren zur Konformitätsprüfung durch private Organisationen und fordert keine staatliche Zertifizierung.
Gleichzeitig gab die Bundesregierung ein Rechtsgutachten in Auftrag. Das Gutachten führt aus: „Die Kommission darf die Prüfung der harmonisierten Norm nicht zum Anlass nehmen, den Normungsprozess praktisch zu duplizieren oder gar eigene technische Regeln an die Stelle der von den Normungsorganisationen konsentierten Inhalte zu setzen.“ [Redeker. (08/2020)]
Hier wird auf die Bedeutung der internationalen Normungsprozesse im Konsensverfahren hingewiesen, in die sich auch die nationalen Normungsorganisationen einordnen.
Insofern besteht grundsätzliche Zustimmung, denn sowohl die EU als auch die Bundesregierung verweisen auf private Organisationen der internationalen Normung zur Schaffung der normativen Basis für neue gesellschaftliche Schwerpunktthemen.
Gleichzeitig betreibt Deutschland nationale Sonderwege.
Der zehnjährige Prozess zur Gestaltung des intelligenten Messsystems verschränkt zwei Regelkreise unter Koordination des Rechtssystems zu stark. Aufgabe der Politik ist die Bestimmung von Anforderungen zur Gewährleistung des Datenschutzes. Insofern erfolgt deren Festlegung über ein vom Rechtssystem definiertes Schutzprofil.
Im nächsten Schritt erfolgte auch die Spezifikation der technischen Umsetzung als normative Basis im Rechtssystem, anstatt auf die zweite Ebene der Gestaltung, die Normungsorganisationen, zurückzugreifen. Das Duplizieren des Normungsprozesses wird mit dem Stufenmodell [BMWi/BSI – Stufenmodell (08/2020)] fortgesetzt. Der nationale Sonderweg der zu engen Verzahnung der beiden Handlungsebenen Rechtssystem und normative Basis birgt Gefahren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit nationaler Unternehmen.
Die Einbindung von Interessenträgern unter der Koordinationsrolle des Rechtsträgers beschreibt den oben ausgeführten zweiten Ansatz, der Rechtssystem und normative Basis unter Koordination des Rechtsträgers und damit die Zeitkonstanten der Handlungsmöglichkeiten eng koppelt.
Das Rechtssystem erhebt somit selbst einen normativen Anspruch.
Schlussfolgerungen
Das Rechtssystem besitzt die Aufgabe, die Rahmenbedingungen für Ziele und Wege zu gestalten und zu überwachen. Dieser durch Politik gestaltete Regelkreis sollte sich auf die rechtlichen Anforderungen mit langfristig wirksamen Steuerungsfunktionen zurückziehen. Diese Anforderungen beziehen sich dabei auf den Einschluss von zentralen Zielstellungen wie Datenschutz, Sicherheit, Ethik, Beteiligung, Erhalt der Demokratie.
Es folgt die technische Ausgestaltung von Maßnahmen entsprechend den Anforderungen des Rechtssystems. Dies sollte der Gestaltungskraft der Gesellschaft durch Schaffung einer normativen Basis im Konsensprozess transdisziplinärer Expertenverbände überlassen werden. Die Koordinationsrolle zur Standardisierung liegt nicht beim Rechtssystem. Die unterschiedlichen Zeitkonstanten zugehöriger Gestaltungsprozesse können die Anwendung technischer Möglichkeiten im internationalen Wettbewerb behindern.
Standards sind Bindeglied zwischen Innovation und Sicherheit gesellschaftlicher Prozesse. Einschränkungen bei Innovationen orientieren sich zuerst an gesellschaftlichen Zielstellungen und Willensbildungsprozessen. Folgende technische Einschränkungen entstehen aus einer notwendigen, normativen Basis, die sich wiederum auf die Anforderungen der Rechtsgrundlagen beziehen kann oder muss. Um Innovationen im internationalen Kontext nicht zu behindern, ist der Einsatz des Rechtssystem zur Gewährleistung der gesellschaftlichen Zielstellungen sorgfältig zu prüfen. Die normative Basis folgt aus einer breiten Zusammenarbeit von Experten in privaten Strukturen von Verbänden, Organisationen und Unternehmen. Sie sollte nicht im Rahmen einer Koordinationsrolle des Rechtssystem mit zugeordneten Behörden unter Einbeziehung einer begrenzten Anzahl von Interessenträgern eingeschränkt werden.
Somit wird insbesondere für das Energiesystem — das zellulär sowohl lokal, national sowie europäisch und im internationalen Kontext zu gestalten ist — die Neuausrichtung des Verhältnisses von Rechtssystem, normativer Basis und Beförderung von Innovationen empfohlen.
Im nächsten Kapitel werden entsprechende Empfehlungen
- zur Umsetzung der EU-Richtlinie zu Erneuerbaren Energien,
- bezüglich der Vorschläge der Bundesnetzagentur zur Netzintegration von Prosumenten,
- zur weiteren Ausgestaltung des intelligenten Messsystems und der Nutzung der zugehörigen Kommunikationseinrichtung (Smart Meter Gateway – SMGW)
- sowie zur nationalen Reform des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes
gegeben.
Quellen
BMWi/BSI – Stufenmodell (08/2020): Herausgeber BMWi / BSI. Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende. Diskussionsentwurf. Berlin, 08/2020.
EU Mitteilung. (11/2018): Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, den Rat und den europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (11/2018) zum Thema „Harmonisierte Normen: Verbesserte Transparenz und Rechtssicherheit für einen uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarkt“. Brüssel, den 22.11.2018
EU Report. (04/2019): Ethics guidlines for trustworthy AI, Brüssel, 18.04.2019. ergänzt am 26.06.2019.
EU Weißbuch. (02/2019): Weißbuch zur künstlichen Intelligenz – ein europäisches Konzept für Exzellenz und Vertrauen, Brüssel, 19. Februar 2019.
Redeker. (08/2020): Rechtsanwältin Kathrin Dingemann und Rechtsanwalt Dr. Matthias Kottmann. Rechtsgutachten zum europäischen System der harmonisierten Normen. Erstellt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Berlin, August 2020.
Leimen, den 27. Oktober 2020
Andreas Kießling, energy design