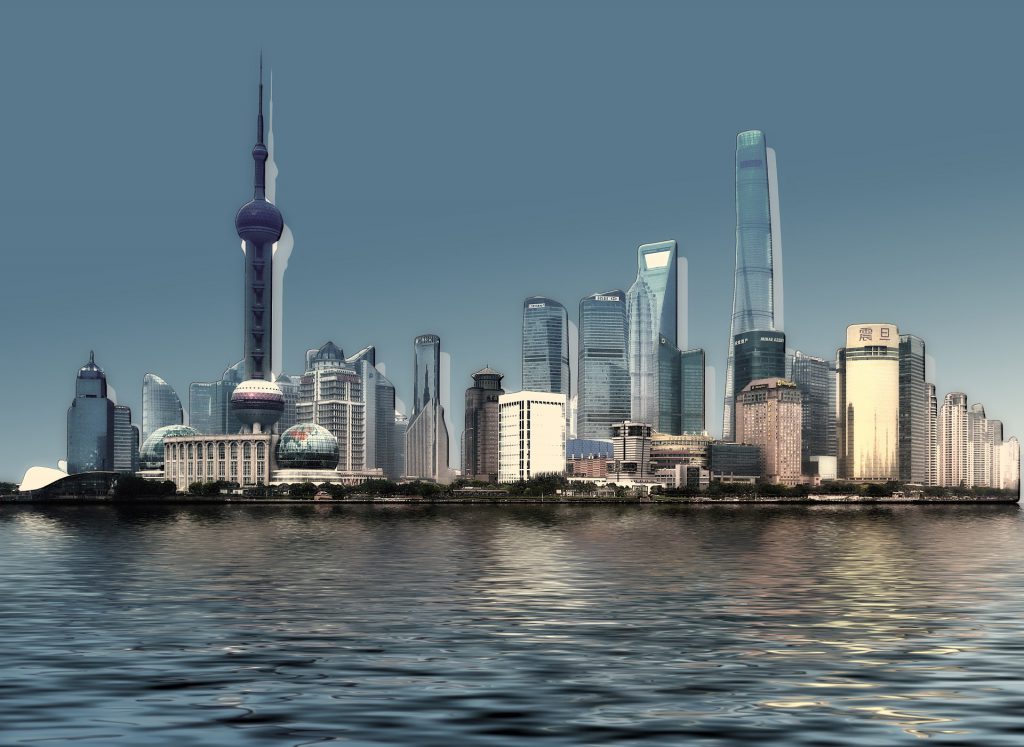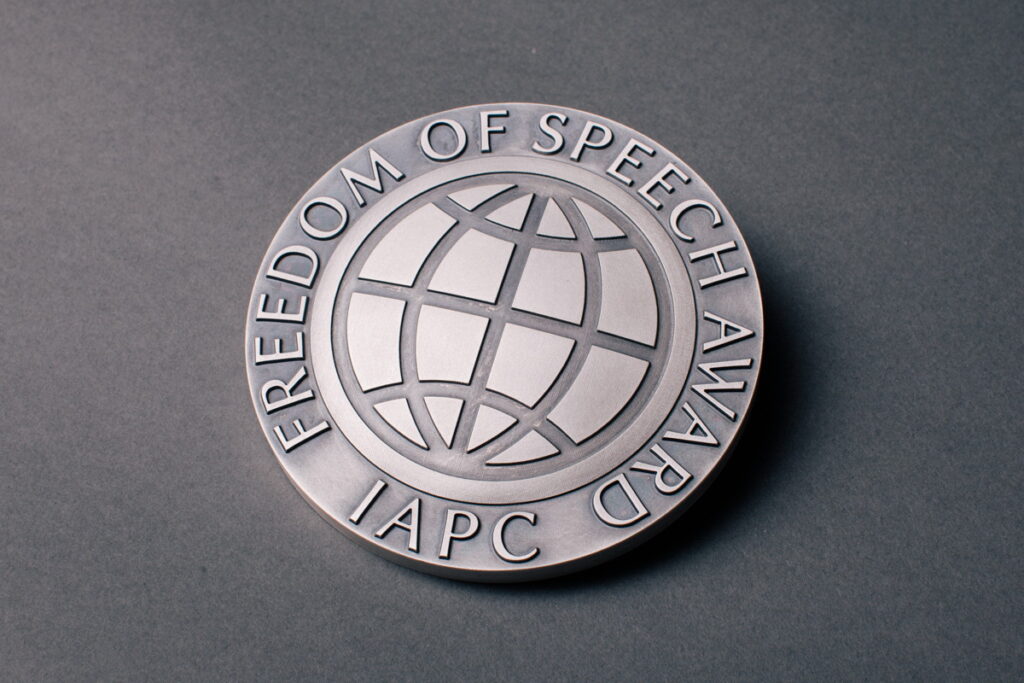Technologische Aspekte der Smart City
Der VDE-Kongreß 2014 zum Thema „Smart City“ in Frankfurt stellte sich der Frage, warum Städte eigentlich schlau werden sollen. Sie beherbergen doch schon eine Vielzahl schlauer Menschen. Denn Wissenschaftler und Ingenieure vermögen mit Informations- und Kommunikationstechnologien heute viel zu tun. Zu bewerten ist dabei, ob alles auch immer getan werden sollte, was machbar erscheint. Mit dem „Machbaren“ verfolgen Unternehmen natürlich auch ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen. Die Deutung zur Ausgestaltung von Smart Cities erfolgt deshalb heute weltweit vorrangig durch große Konzerne. Denn sie ringen um Marktanteile auf einem jungen globalen Markt. Insofern wird mit dem Begriff Smart City zuerst eine technische Zielstellung adressiert.
Über den Einsatz innovativer Informations- und Kommunikationstechnologien sind Lösungen für ganz unterschiedliche Bereiche der Stadtentwicklung bereitzustellen. Dies umfasst die Stadtdomänen Infrastruktur, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen und Sicherheit. Dabei werden schon konkrete technische Lösungen mit entsprechenden Standardisierungsanforderungen spezifiziert. Aber der eigentliche Nutzen für die Stadt wird oft noch abstrakt beschrieben. Deshalb fordern gerade Städtevertreter, das Ziel der Smart City zuerst aus der Sicht des Planungshandelns im veränderten gesellschaftlichen Umfeld zu definieren. Auf dieser Grundlage sind die sinnvollen, technologischen Mittel zu identifizieren, in Stadtentwicklungspläne zu integrieren und für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu nutzen.
Smartness der Community in einer vernetzten Welt
Der technische Begriff der Smartness zur Verknüpfung getrennter Komponenten durch Kommunikation und Software definiert sich sicherlich auf andere Weise als die Smartness unter Ausnutzung der Intelligenz der Community, die sich durch „die zunehmende Beteiligung der Bevölkerung, der Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Industrie, Stadtgesellschaft und Politik im Steuerungs- und Umsetzungsprozess der planerischen Ziele“ [Urban 2.0: Lojewski, Hilmar. Deutscher Städtstag: Smart City definiert sich überall anders. Ausgabe 3, 2014] ausbildet. Die dritte Form der Smartness entsteht durch die intelligente Aufbereitung von Daten in Echtzeit unter der Bezeichnung Smart Data. Hier muss aber sehr kritisch das Verhältnis zwischen privaten Daten sowie von geteilten Daten zum Erhalt von Privatheit hinterfragt werden.
Die Übertragung von Daten in abgegrenzte Gruppen und in die Öffentlichkeit erfolgt zum Zwecke des Bereitstellung und Nutzung neuer Dienstleistungen. Die Smart City stellt sich dabei den Herausforderungen der notwendigen nachhaltigen Stadtentwicklung sowie der Erhöhung des Lebens- und Wirkungskomforts für alle Bürger, die Wirtschaft und die Verwaltung. Dabei sind Synergien bei der Einbeziehung aller gesellschaftlichen Kräfte in der Gestaltung der Community sowie neuen Möglichkeiten das Planungshandeln und der Führung städtischer Prozesse durch IKT-Technologien zu erschließen.
Die Smart City ist gekennzeichnet durch eine neue Vielfalt im Wirken von Beteiligten in verschiedenen Lebensbereichen wie Energie, Mobilität, Gesundheit, Logistik und Sicherheit, aber auch durch die zunehmende Vernetzung dieser Vielfalt. Dies wiederum erzeugt neue Organisationsformen. Dies betrifft die Ausbildung neuer sozialer Netzwerke, aber auch neue wirtschaftliche Teilhabemodelle (Sharing). Daraus folgt eine zunehmende Komplexität, die neue Eigenschaften hervorbringt. Aus der Herausbildung neuer Eigenschaften, die mit dem Begriff Emergenz umfasst werden, resultieren neue Chancen. Die komplexe Gesamtheit bietet der Gesellschaft der Einzelnen mehr als die Summe der Einzelaktivitäten ermöglicht.
Dezentrale Selbstorganisation und Gestaltungshoheit der Smart City
Die Ausbildung der zunehmenden Komplexität benötigt zu ihrer Beherrschung mehr Eigenverantwortung und dezentrale Selbstorganisation. Dezentrale Selbstorganisation wiederum erhöht die Bedeutung der Städte in Staatsgebilden. Globalisierung und notwendige Subsidiarität bilden also eine Einheit. In diesem Umfeld benötigen wir die Sicherstellung von Individualität durch Maßnahmen zur Sicherstellung von Privatheit sowie die Erhöhung der Freiheitsgrade des Handelns in der Stadt für mehr Wirkungsmöglichkeiten, um die Akzeptanz für Vernetzung bei den Menschen zu erreichen. Die Smart City als Zelle in einer intelligenten Welt schafft eine Art Blutkreislauf und Nervensystem im Organismus Stadt mit Smart Grids als gemeinsames Energie- sowie Informations- und Kommunikationssystem der Einzelnen. Die Smart City muss aber ebenso die Privatheit der Einzelnen als eigenständige Zellen des Organismus sicherstellen.