Vielfalt und Lebensdienlichkeit durch Autonomie sowie Sicherheit und Dynamik durch Gemeinschaft
Das Zulassen von Vielfalt und Lebensdienlichkeit durch Autonomie ist Quelle von Differenzen und damit von Gestaltung. Auf der anderen Seite ist Verbundenheit Ursache der Kraft, Unterschiede zur Entfaltung von dynamischer Entwicklung und Sicherheit in der Gemeinschaft zu nutzen.
Diese Grundidee führte zum zellularen Ansatz bei der Gestaltung des Energiesystems. Dabei ist das Architekturkonzept Grundlage der Massenfähigkeit neuer Handlungsräume für die Menschen und Unternehmen in den Regionen. Es ermöglicht Eigenverantwortung, Gestaltungshoheit bei der Planung in Kommunen sowie gleichzeitig Solidarität im Verbund.
Dazu wird die Beförderung von Eigenstromverbrauch, von Mieterstrommodellen sowie der lokale Austausch von Energie in Gebäuden und Stadtquartieren benötigt. Die Zentralisierung der Energiewirtschaft und die zunehmende Regulierung technischer Details durch den Staat behindert den Erfolg der Energiewende sowie die dafür notwendige Beteiligung und Eigeninitiative.
Autonome Gestaltungshoheit, Beteiligung, Zusammenwirken und das Primat der Lebensdienlichkeit sind Teil einer neuen integrativen Wirtschaftsethik (Konzept einer lebensdienlichen Ökonomie).
Autonome Gestaltung ermöglicht Autarkie und Lebensqualität im Notfall
Fürchterliche Wörter bestimmen die Diskussion zum Umbau des Energiesystems. An vorderster Stelle stehen dabei die Begriffe „Marktdienlichkeit“, Netzdienlichkeit“ oder „Systemdienlichkeit“. Sie entstammen dem Streit der Experten um die Gestaltung und die Architektur des zukünftigen, nachhaltigen Energiesystems. Es ist eine interdisziplinäre Diskussion der Energiewirtschaft, der Hersteller, der Beratungsunternehmen sowie der Wissenschaftler aus den Bereichen Energietchnik und Energiemarkt. Man spricht von der notwendigen Partizipation der Energienutzer aus allen Lebensbereichen. Aber gerade diese Partizipanten fehlen oft bei der Bestimmung des Weges in die Energiezukunft. Wir benötigen nach über einem Jahrzehnt des intensiven interdisziplinären Austausches verstärkt das transdisziplinäre Zusammenwirken.
Energie als Ursache von allem wird in der Physik als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, beschrieben. Das Angebot von Energie ist Grundlage von Arbeit in der Gesellschaft und somit Treiber von Wohlstand. Länder mit nicht ausreichendem Zugriff auf Energie gehören zu den ärmsten Ländern auf dem Planeten Erde. Nun kann der nicht nachhaltige Zugriff auf die Quellen von Energie und Rohstoffen zu einer unumkehrbaren Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen führen. Somit wird der Wandel zu einem nachhaltigen Wachstum mit erneuerbaren Energien und geschlossenen Stoffkreisläufen benötigt. Aus der Fähigkeit von Energie zur Arbeitsverrichtung resultieren grüne Jobs sowie die Möglichkeit zur Selbstversorgung in Gebäuden und Stadtquartieren.
Vorrangig zu betrachten ist also zuerst die „Lebensdienlichkeit“ der Gestaltung von Energiekreisläufen. Menschen wollen in ihrem Lebensumfeld nicht netzdienlich oder marktdienlich sein. Menschen möchten in den Gebäuden gestalten, Komfort erhöhen, Kosten optimieren, Freude erleben sowie Sicherheit spüren. Das Gebäude soll den Menschen Lebensdienlichkeit bieten, gar „überlebensdienlich“ sein. Aus ideellen, gemeinschaftlichen und auch materiellen Aspekten kann ein netzdienliches und marktdienliches Verhalten folgen.
Beispiele für Zielstellungen der Lebensdienlichkeit
“Meine Frau hat die unheilbare Krankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) und benötigt 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche ununterbrochene nicht-invasive Beatmung. Die notwendige Stromversorgung für die zwei dafür eingesetzten Geräte ist jeweils durch eine Notfallversorgung mit Akkus abgesichert, die vier Stunden Energie liefern. Ein Gerät für den Tag und eines für die Nacht. Ein 10-stündiger Stromausfall würde wahrscheinlich … unvorstellbar.
Beatmungsgeräte für invasive beziehungsweise nicht-invasive Beatmung sind tausendfach im Einsatz! Grobe Schätzungen gehen von mehreren 100.000 Geräten aus!
Es müssen unbedingt „überlebensdienliche“ Lösungen in Form von kleinen autarken, kostengünstigen Systemen implementiert werden, um im wirklich großen oder kleinen Notfall Überlebenschancen für viele – besonders für Schwache – zu bieten.“
Die Lebensdienlichkeit für die Funktion einer Stadt beschreibt ein Oberbürgermeister mit folgenden Worten:
“Ich habe die Aufgabe, die Funktion der Verwaltung auch im Katastrophenfall sicherzustellen und suche dafür Lösungen. Regelmäßig tauschen wir uns dazu auch mit den Vertretern anderer Kommunen aus.“
“Bei Stromausfall im Stadtnetz muss die Pumpe meines Aquariums weiterfunktionieren.“
Die Überlebensdienlichkeit für die Fische im Aquarium ist somit Ausgangspunkt der Gestaltung der Fähigkeit zur autarken Energieversorgung.
Zur Umsetzung beispielhafter Aspekte von Lebensdienlichkeit erfolgte die nachfolgend beschriebene Pilotierung im Rahmen des Lab Noir.
C/sells demonstriert die Lebensdienlichkeit des Inselbetriebes bei Netzausfall
Mehrere Projektpartner des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten C/sells-Projektes haben am 22. Mai beim sogenannten “Lab Noir“ im Realbetrieb die kurzfristige Versorgung von zwei Gebäuden im Inselnetzbetrieb bei einem simulierten regionalen Netzausfall und die anschließende Resynchronisation mit dem Verteilnetz demonstriert. Unter Mitwirkung von Fichtner IT Consulting, Fraunhofer IEE, den Stadtwerken Schwäbisch Hall sowie Andreas Kießling energy design wurde ein Lösungsweg zur Führung einer Energiezelle im abgesicherten Übergangsbetrieb am Beispiel der zwei Reihenhäuser in Leimen bei Heidelberg erfolgreich eingeführt. Dieses Szenario wurde beim Lab Noir gemeinsam mit den Stadtwerken Schwäbisch Hall als Verteilnetzbetreiber vor Ort durchgespielt.
Nachfolgende Schilderung des Ablaufes erfolgt aus Sicht von drei Akteuren, um verschiedene Aspekte der „Dienlichkeit“ einer Funktion im Energiesystem aufzuzeigen.
Lebensdienlichkeit für Gebäude‑, Quartiers- und Arealbetreiber
Erneuerbare Energie, zellulare Systemkonzepte und Digitalisierung bieten neue Möglichkeiten zur Eigengestaltung von Energiekreisläufen und deren Lebensdienlichkeit. Dabei trifft dies sowohl für Wohngebäude, kommerzielle Gebäude, Stadtquartiere als auch für gewerbliche Arealen und Industriegebiete zu. In Gebäuden mit Energiegewinnung, Speicherung, Netzersatzanlagen und Managementsystemen kann bei externen Ausfällen die Netzabtrennung und autarke Versorgung erfolgen.
Nachfolgend wird im Gebäude die korrekte Frequenz und Spannung aufrechterhalten sowie der Energiefluss zwischen Erzeugern, Speichern und Verbrauchern gesteuert. Bei nicht ausreichendem Energieangebot im Gebäude kann ein Notbetrieb für die wichtigsten Verbraucher umgesetzt werden. Dabei besteht die Möglichkeit, nicht zwingend benötigte größere Verbraucher von der Versorgung zu trennen.
Wenn der externe Energiefluss wieder zur Verfügung steht, erfolgt durch die Netzersatzanlage des Gebäudes wieder die Zuschaltung zum umgebenden Netz.
Im Rahmen einer ersten Demonstration im Nachbarschaftsverbund aus zwei Reihenhäusern in Leimen auf der Rudolf-Diesel-Straße bei den Familien Andreas Kießling und Marc Berghaus wurde dieses Verfahren am 22. Mai 2019 beim Lab Noir vorgestellt.
Das Thema betrifft jedoch alle Wohnquartiere, gewerbliche Areale, Infrastrukturbetriebe als auch Flughäfen oder Industriegebiete.
Netzdienlichkeit Netzbetreiber Stadtwerke Schwäbisch Hall
Im simulierten Netzbetrieb ging am 22. Mai gegen 18 Uhr über ein Verbundsystem des Landes Baden-Württemberg (ASBW) in der Leitwarte der Stadtwerke Schwäbisch Hall die Meldung über einen Netzausfall in allen 22 angeschlossenen Verteilnetzen ein. Die im Netzsimulator für den Netzwiederaufbau geschulten Techniker der Stadtwerke Schwäbisch Hall eröffneten nun den Prozess „Inselnetzaufbau“. Das Führungskraftwerk nahm den Betrieb auf. Sukzessive wurden hiermit die weiteren Kraftwerke und Abnehmer versorgt. Das Netz Schwäbisch Hall lief in der Folge stabil als Inselnetz. Während dieser Zeit wurde das Reihenhaus in Leimen über die im Gebäude eingebaute Batterieanlage versorgt.
Im Szenario erfolgte anschließend der Wiederaufbau des Verbundnetzes im Bundesland. Daraufhin erhielt der Dispatcher die Meldung, die Leistung zu erhöhen und alle verfügbaren Reserveaggregate hochzufahren. Parallel wurde das Netz wieder synchronisiert.
Durch den Versand eines Signales an die Steuerbox im Reihenhausverbund erfolgte die Meldung, dass das Niederspannungsnetz wieder zur Verfügung steht. Hiermit konnte das Gebäude für den Prozess der Wiedersynchronisierung mit der Umgebung wieder freigegeben werden.
Bei einem breiten, unkoordinierten Einsatz eines solchen Netzersatzbetriebs könnte der Netzwiederaufbau nach einer größeren Störung wesentlich erschwert werden. Ohne Koordination sind die Lastflüsse im Netz, das sich noch in der Stabilisierungsphase befindet, kaum vorhersehbar. Im Rahmen des Lab Noir wurde die Wiedersynchronisation durch den Verteilungsnetzbetreiber gesteuert. Auf diese Weise ermöglicht die Lebensdienlichkeit des Gebäudes mit Netzersatzbetrieb als potenzieller Störfaktor die zusätzliche Netzdienlichkeit beim Netzwiederaufbau.
Marktdienlichkeit für Anbieter von Solaranlagen und Energiemanagementsystemen
Für Anbieter von Solaranlagen ist eine funktionierende Inselnetzfähigkeit insbesondere zur Optimierung des Eigenverbrauches erzeugten Solarstromes als Grundlage der Lebendienlichkeit interessant. Nach Auslaufen der EEG-Förderung wird die Bedeutung der Gestaltung von Autonomie und Eigenverbrauch in Gebäuden, Quartieren und Arealen als Energiezellen wachsen. Das zusätzliche Angebot zur Autarkie im externen Störungsfall verstärkt das Leistungsangebot der Anbieter von Solaranlagen und Energiemanagementsystemen.
Nach Herstellerangaben wird inzwischen mehr als jede vierte PV-Anlage mit einem inselnetzfähigen Wechselrichter installiert. Somit werden Produkte bereitgestellt, die sowohl den zeitweiligen, autarken Betrieb und den Wiederaufbau des Verbundnetzes unterstützen als auch den Betreibern von Liegenschaften und Anlagen neue Chancen beim Einsatz des Solarstromes in Gebäuden sowie bei der Interaktion mit Energiemärkten und Energienetzen bieten.
Im Rahmen vom Lab Noir wurde die begrenzte Autarkie bei externem Spannungsausfall durch jeweils ein Energiemanagementsystem pro Gebäude ermöglicht. Dabei übernahm der Batteriespeicher, der über die auf dem Hausdach installierte PV-Anlage gespeist wird, die Versorgung beider Reihenhäuser.
Ziel war es, in der Übergangsphase des Netzausfalles möglichst lange die Versorgung in beiden Gebäuden zu gewährleisten. Deshalb wurden an den im Gebäude benötigten Verbrauchern Sensoren eingebaut, die den Leistungsbedarf sekündlich erfassten und diese Information den Energiemanagementsystemen zur Begrenzung und Priorisierung des Leistungsbedarfes bereitstellten. Somit wurde die zeitliche Staffelung der Gerätenutzung unter den Bedingungen einer Leistungsgrenze im Notfallbetrieb ermöglicht.
Der Geräteeinsatz, die bezogenen Leistungen und der Speicherstand wurden durch das Energiemanagementsystem auf mobilen Endgeräten dargestellt. Der Nutzer erhielt hiermit die Möglichkeit, die Priorisierung der Gerätenutzung zu beeinflussen. Mittels der Sensoren wurde Beginn und Ende des Ausfalles erkannt und somit die Phase des Notbetriebes gestartet und beendet.
Die Integration des Energiemanagementsystems mit Inselnetzfähigkeit in Lösungen für intelligente Gebäude kann wirtschaftliche und attraktive Anwendungen in kleineren Objekten befördern. Das prioritätenbasierte Energiemanagement und die modulare Realisierung mittels der Plattform OGEMA stellen somit eine wesentliche Weiterentwicklung gegenüber bestehenden Lösungen dar.


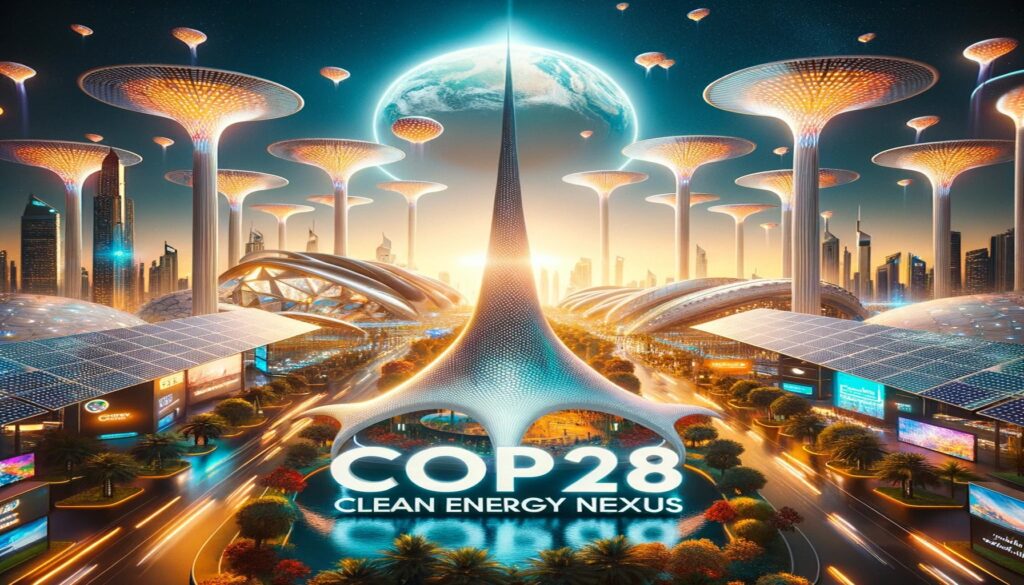

Autarke Inseln werden zunehmend an Bedeutung gewinnen, unabhängig von der Stärke der Umweltbelastung. Krankenhäuser und andere Einrichtungen, bei dem das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, brauchen jetzt schon unabhängige Energieversorgungen. Auch die Versorgung mit Internet erfordert ein Mindestmaß an Leistung, die dann dem Zusammenbruch anderer Systeme entgegenwirken kann. Der Netzwiederaufbau nach der Störung ist offenbar hier schon gut gelungen, ich gratuliere zu diesem Erfolg!