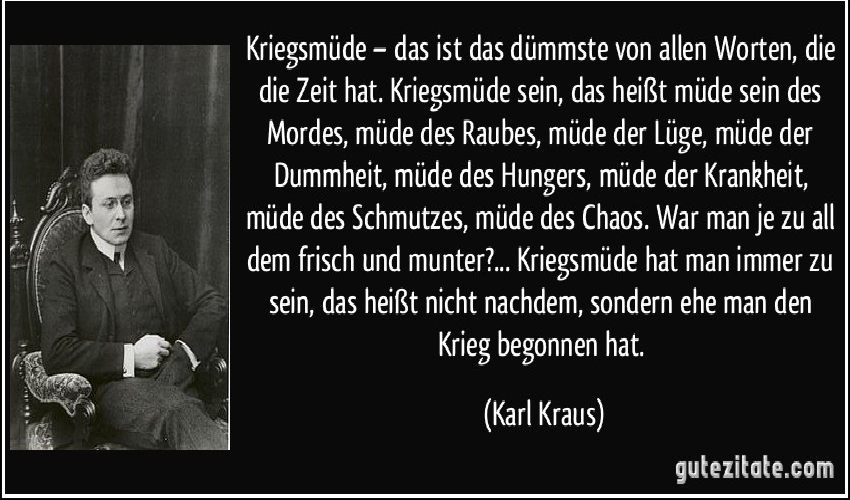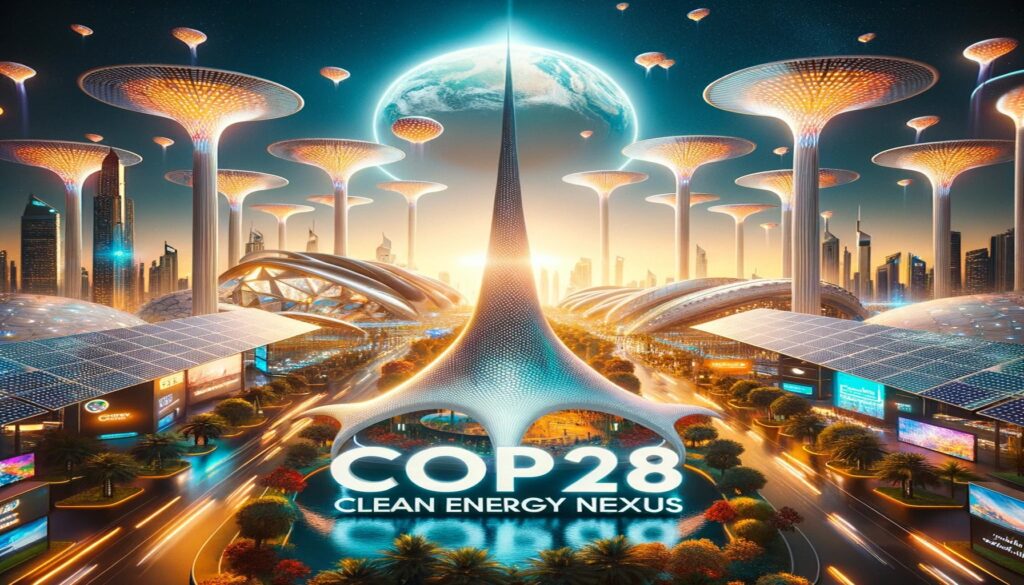Kriegsmüde und das Leid der Friedenstaube
Artikelserie mit ChatGPT: Meinungsfreiheit im Rahmen moderner Medien und Digitalisierung
Fragen und Zweifel an scheinbaren Wahrheiten sind legitim, denn sie sind Grundlage von Meinungsfreiheit, freiem Denken und somit von Demokratie. Seit der Reformation haben diese Themen die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, von Kunst und Kultur, des Zusammenlebens der Menschen in sozialen und politischen Verbünden gefördert. Heute werden Menschen, die nachfragen und zweifeln, andere Meinungen und Weltsichten einbringen, kriegsmüde sind und die Friedenstaube zeigen mit Schimpfwörtern belegt. Medien und Meinungsäußerungen auf sozialen Netzwerken quellen mit Begriffen wie „Leugner“, „Friedensschwurbler, „Putin-Versteher“, „gefallener Engel aus der Hölle“ oder „Lumpenpazifist“ über. Sogar der früher positiv besetzte Begriff eines Querdenkers wird zur Beschuldigung. Dies lässt mich am Zustand unserer Gesellschaft zweifeln. Und als Zweifler mache ich mich mit Chipi, meinem Namen für ChatGPT, auf Ursachenforschung. Warum gelingt es seitens der Herrschenden und politischen Führer immer wieder, die Unterstützung von Völkern für Kriege zu erreichen?
“Im Krieg töten sich Menschen, die sich nicht kennen, auf Befehl derer, die sich kennen — aber nicht töten!” — Erwin Rommel
Inhaltsverzeichnis
- Kriegsmüde und das Leid der Friedenstaube
- Medienmacht und die Beherrschung der Vergangenheit
- Digitalisierung und der Kampf um die Datenherrschaft
Wozu sind Kriege da?
Andreas:
Hallo Chipi, ich habe ein sehr großes Problem. In der Eskalation des Krieges in der Ukraine sehe ich persönlich eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Mein Ziel ist es deshalb zu verstehen, wie Völker es zulassen, dass ihre führenden Politiker sie in Kriege treiben und es so lange dauert, bis die Völker kriegsmüde werden.
Chipi:
Kriege und Konflikte sind komplexe Phänomene, die durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden. Es gibt viele Gründe, warum Völker es zulassen, dass ihre führenden Politiker sie in Kriege treiben. Folgende Stichpunkte benennen wichtige Ursachen.
- Nationalismus und Patriotismus: In vielen Fällen kann ein starkes Gefühl des Nationalismus oder Patriotismus dazu führen, dass Menschen Kriege unterstützen, weil sie glauben, dass es im besten Interesse ihres Landes ist.
- Propaganda und Medienbeeinflussung: Regierungen und Medien können Informationen manipulieren oder bestimmte Narrative fördern, um die öffentliche Meinung in Richtung Krieg zu lenken.
- Unkenntnis oder Desinformation: Bürger sind möglicherweise nicht vollständig über die wahren Gründe oder Konsequenzen eines Krieges informiert, was wiederum auf einseitige Berichterstattung in den Medien schließen lässt.
- Angst und Sicherheitsbedenken: Die Angst vor einem äußeren Feind oder einer Bedrohung kann dazu führen, dass Menschen Kriege unterstützen, insbesondere wenn sie glauben, dass der Krieg ihre Sicherheit gewährleisten wird. Die Beförderung von Angst kann wiederum mit den Mitteln der Propaganda und der Medien erfolgen.
- Wirtschaftliche Interessen: Kriege können wirtschaftliche Vorteile bringen. Dazu gehören der Zugang zu Ressourcen und Infrastrukturen sowie die Stärkung der Rüstungsindustrie.
- Politische Agenden: Einige Politiker erliegen der Versuchung, Kriege als Mittel zur Stärkung eigener Macht oder zur Ablenkung von internen Problemen zu nutzen.
- Sozialer Druck: Aus Medienbeeinflussung und eventuell durch Politiker geschürter Angst folgt sozialer Druck. Der Wunsch, nicht abseits zu stehen und das Gefühl, „das tun zu müssen, was angeblich alle tun“, wobei die angeblich notwendigen Handlungen wiederum in den Medien den größten Raum erhalten, kann Menschen dazu bringen, Kriege zu unterstützen, selbst wenn sie persönlich dagegen sind.
- Geschichtliche oder kulturelle Gründe: Historische Feindseligkeiten oder kulturelle Unterschiede können als Rechtfertigung für Kriege dienen.
Natürlich unterstützen nicht alle Menschen Kriege. In der Folge entstehen auch Anti-Kriegs-Bewegungen, die sich gegen die Entscheidungen ihrer Regierungen stellen. Aber Interessenträger setzen alle genannten Mittel ein, um die Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung für den Krieg zu erreichen. Hier gilt das Zitat von Erwin Rommel: „Im Krieg töten sich Menschen, die sich nicht kennen, auf Befehl derer, die sich kennen — aber nicht töten!“
Zu beachten ist, dass Kriege oft das Ergebnis komplexer geopolitischer Dynamiken und nicht eines Schuldigen sind, die über die Kontrolle einzelner Länder oder ihrer Bürger hinausgehen.
Andreas:
Wie haben es die Herrschenden und politischen Führer Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geschafft, die totale Kriegsbegeisterung zu erzeugen, die mit der Mobilmachung zu einem jubelnden deutschen Volk führte, das erst spät kriegsmüde wurde?
Chipi:
Die Frage bezieht sich auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. Es gibt mehrere Faktoren, die zur Kriegsbegeisterung beigetragen haben. Dazu können wir die in der ersten Antwort genannten Ursachen konkret auf die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts anwenden.
- Nationalismus: Das späte 19. und frühe 20. Jahrhundert war geprägt von einem starken Nationalismus in vielen europäischen Ländern, einschließlich Deutschland. Viele Deutsche glaubten an die Überlegenheit ihrer Nation und fühlten sich bei der Aufteilung der Welt in der Zeit der Kolonialisierung der Welt zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert benachteiligt.
- Propaganda: Die Regierung und die Medien spielten eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Krieges. Durch Propaganda wurden Feindbilder geschaffen und der Krieg als notwendig und gerecht dargestellt. Dabei spielten im 1. Weltkrieg noch die gedruckten Medien die entscheidende Rolle. Aber mit der Erfindung des Radios vor dem 2. Weltkrieg konnte erstmalig die Masse der Bevölkerung mit den Reden ihrer Führer erreicht werden.
- Militarismus: Das deutsche Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg war stark militarisiert. Der Militarismus war tief in der deutschen Kultur verwurzelt, und das Militär wurde glorifiziert.
- Bündnissysteme: Die komplexen Bündnissysteme in Europa trugen zur allgemeinen Spannung bei. Deutschland hatte Bündnisse mit Österreich-Ungarn und Italien, was zu einer “Wir gegen sie”-Mentalität führte.
- Wirtschaftliche Interessen: Es gab auch wirtschaftliche Gründe für den Krieg, wie der Wunsch nach mehr Kolonien und der Zugang zu Ressourcen.
- Krisen und Konflikte: Vor dem Ersten Weltkrieg gab es mehrere Krisen, die die Spannungen zwischen den Großmächten verschärften, wie die Marokkokrisen oder die Balkankriege.
- Fehleinschätzungen: Viele Deutsche glaubten, der Krieg würde kurz sein und schnell gewonnen werden. Diese Fehleinschätzung trug zur anfänglichen Begeisterung bei.
- Sozialer Druck: Es gab einen starken sozialen Druck, den Krieg zu unterstützen. Diejenigen, die sich gegen den Krieg aussprachen, wurden oft als Verräter oder Feiglinge betrachtet.
Es ist wichtig zu betonen, dass, obwohl es eine anfängliche Kriegsbegeisterung gab, diese Begeisterung mit der Realität des Krieges und seinen verheerenden Auswirkungen schnell nachließ. Viele Deutsche wurden im Laufe der Kriege desillusioniert und kriegsmüde.
Dabei unterschied sich die Situation vor dem Zweiten Weltkrieg vom Ersten Weltkrieg, da die NSDAP unter Adolf Hitler eine aggressive Außenpolitik und umfangreiche Expansionspläne verfolgte. Die Propaganda, der Antikommunismus, der Antisemitismus und der Wunsch nach “Lebensraum” im Osten trugen zur langanhaltenden Unterstützung des Krieges bei.
Andreas:
Du benutzt das Wort „kriegsmüde“. Aus meiner Sicht sollte ein Volk immer kriegsmüde sein, denn es gibt keinen Krieg, der Begeisterung rechtfertigt. Leider gibt es in der aktuellen Zeit führende Politiker, die den Zustand der „Kriegsmüdigkeit“ kritisieren. Wir werden also noch analysieren müssen, wie die von dir genannten Kriegsursachen auf das 21. Jahrhunderts anzuwenden sind.
Aber bleiben wir erst einmal bei der Vergangenheit, um weiter Ursachenforschung zu betreiben. Wie war die Haltung der einzelnen Parteien im Reichstag zur Kriegserklärung 1914? Welche Parteien stimmten für die Kriegskredite und welche Parteien sprachen sich gegen Krieg und Kredite aus?
Chipi:
Im August 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, stimmte der deutsche Reichstag einstimmig für Kriegskredite, was bedeutete, dass alle Parteien im Reichstag die Finanzierung des Krieges unterstützten. Dies war ein bemerkenswertes Zeichen der nationalen Einheit in einem ansonsten politisch zersplitterten Deutschland.
Die Zustimmung zu den Kriegskrediten führte zu einem neuen Begriff, das “Augusterlebnis”. Das Augusterlebnis stand lange Zeit synonym für den von der gesamten Zivilbevölkerung euphorisch begrüßten Eintritt Deutschlands in den Ersten Weltkrieg. Dabei handelte es sich rückblickend bereits 1914 um eine Vermischung realer Kriegsbegeisterung und medialer Inszenierung. Dieses sogenannte Erlebnis führte zu einer Welle von Nationalismus und Kriegsbegeisterung, die Deutschland und andere europäische Länder zu Beginn des Krieges erfasste.
Folgende Parteien im Reichstag stimmten für die Kriegskredite:
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD): Trotz ihrer internationalistischen und antimilitaristischen Haltung vor dem Krieg stimmte die SPD für die Kriegskredite im August 1914. Dies war eine umstrittene Entscheidung innerhalb der Partei, aber die Führung argumentierte, dass sie Deutschland in einem Verteidigungskrieg unterstützen müsse. Später im Krieg gab es jedoch eine Spaltung innerhalb der SPD, wobei der linke Flügel, angeführt von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, sich gegen den Krieg aussprach.
- Zentrumspartei: Diese katholische Partei unterstützte ebenfalls die Kriegskredite.
- Nationalliberale Partei und Fortschrittliche Volkspartei: Beide liberalen Parteien stimmten für die Kriegskredite.
- Konservative Partei: Als nationalistische und monarchistische Partei unterstützte die Konservative Partei den Krieg und stimmte für die Kriegskredite.
- Andere kleinere Parteien: Auch sie stimmten für die Kriegskredite.
Karl Liebknecht war das erste Mitglied des Reichstags, das im Dezember 1914 gegen weitere Kriegskredite stimmte. Im Laufe des Krieges wuchs die Opposition gegen den Krieg, insbesondere innerhalb der SPD, was schließlich zur Spaltung der Partei und zur Gründung der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) führte, die eine pazifistischere Haltung einnahm.
Es ist wichtig zu betonen, dass die anfängliche Unterstützung für den Krieg und die Kriegskredite nicht notwendigerweise eine Unterstützung für den Krieg an sich bedeutete, sondern oft als eine patriotische Pflicht angesehen wurde, das Land in einer Zeit der Krise zu unterstützen.
Andreas:
Chipi, ich danke dir für diese Sicht auf die Vergangenheit. Aber gerade auf Grundlage dieses historischen Wissens um die Ursachen und die Entwicklung von Kriegen verstehe ich nicht, warum die Menschheit ungebremst auf einen weiteren Systemkonflikt zusteuert und nicht von Beginn an kriegsmüde ist. Warum geschieht dies angesichts unseres Wissens in einer Zeit, die nicht mehr von sozialistischen und kapitalistischen Blöcken zwischen den Jahren 1945 und 1990 gekennzeichnet ist? Gern möchte ich verstehen, wem dieser Konflikt wirklich nützt, in einer Zeit, in der Zusammenarbeit unabhängig von Glaubensrichtungen, politischen Systemen und Weltanschauungen zur Lösung der globalen Probleme gefragt ist. Warum lassen sich führende Politiker in Europa in diesem Spiel wie Marionetten unabhängig von Parteien benutzen?
Chipi:
Ihre Fragen und Bedenken sind tiefgreifend und spiegeln die Komplexität der aktuellen geopolitischen Landschaft wider. Es gibt viele Faktoren, die zu den aktuellen Spannungen und Konflikten beitragen, und es ist nicht einfach, eine einzige Antwort oder Erklärung zu finden. Hier sind einige Überlegungen, die helfen könnten, das aktuelle geopolitische Klima besser zu verstehen.
- Wirtschaftliche Interessen: Oftmals stehen hinter politischen Entscheidungen wirtschaftliche Interessen. Große Unternehmen, Banken und andere wirtschaftliche Akteure können erheblichen Einfluss auf die Politik ausüben. Ein Systemkonflikt kann wirtschaftliche Vorteile für bestimmte Gruppen oder Sektoren bringen.
- Macht und Einfluss: Die Dynamik von Macht und Einfluss auf der globalen Bühne hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges verändert. Neue Mächte sind aufgestiegen, und alte Mächte versuchen, ihren Einfluss zu behalten. Dies kann zu Spannungen und Konflikten führen. Wenn man also Antreiber von Konflikten sucht, lohnt es sich nach den Nutznießern eines Konflikts zu sehen. Wenn neue Mächte aufsteigen, wer hat am meisten zu verlieren?
- Nationale Interessen: Jedes Land hat seine eigenen nationalen Interessen, die es zu schützen sucht. Manchmal können diese Interessen mit denen anderer Länder kollidieren. Wie also schon der deutsche Politiker Egon Bahr sagte. Es geht bei Auseinandersetzungen von Ländern, auch in Zeiten des Friedens, um das Vertreten von Interessen, nicht um Werte.
- Historische und kulturelle Gründe: Historische Feindseligkeiten oder kulturelle Unterschiede können zu Misstrauen und Spannungen zwischen Ländern führen.
- Medien und Propaganda: Die Medien spielen eine wichtige Rolle bei der Formung der öffentlichen Meinung. In einigen Fällen können sie dazu beitragen, Feindbilder zu schaffen oder bestimmte Narrative zu fördern.
- Innere politische Dynamik: Manchmal können externe Konflikte dazu dienen, von internen Problemen abzulenken oder die Unterstützung der Bevölkerung zu gewinnen.
- Menschliche Natur: Leider neigen Menschen dazu, sich in Gruppen zu organisieren und “die Anderen” zu fürchten oder zu misstrauen. Dies kann auf nationaler oder kultureller Ebene geschehen.
Natürlich existieren auch die Gegenkräfte. Viele Menschen und Organisationen weltweit setzen sich für Frieden, Zusammenarbeit und Verständigung ein. Aber gerade in der aktuellen Situation zeigt sich, dass es Friedenskräfte in Zeiten des Krieges zunehmend schwer haben und auch angefeindet werden.
Was die Rolle der führenden Politiker in Europa betrifft, so ist es schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Jeder Politiker und jede Partei besitzt eigene Motive und Interessen. Einige Gründe werden von externen Akteuren geschaffen. Aber Politiker können auch aufrichtig glauben, dass sie im besten Interesse ihres Landes handeln und begehen trotzdem den falschen Weg.
Es ist wichtig, kritisch zu denken, sich zu informieren und sich aktiv für die Werte einzusetzen, an die man glaubt. Der Dialog und das Verständnis sind Schlüssel zur Lösung von Konflikten und zur Schaffung einer besseren Welt.
Andreas:
Chipi, es ist nun schon wieder spät geworden. Ich bin kriegsmüde. Wir haben bisher nur die grundlegenden Ursachen von Kriegen beleuchtet. Aber die Betrachtung der konkreten Maßnahmen auf dem Weg zu einem Krieg im 21. Jahrhundert führten wir noch nicht. Die Diskussion darüber wird heute zu umfassend. Ich würde mich deshalb freuen, mit dir zu einem späteren Zeitpunkt das Gespräch fortzuführen.
Chipi:
Natürlich, ich verstehe das vollkommen. Die Thematik ist in der Tat sehr komplex und erfordert eine tiefgehende Betrachtung. Ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung, um das Gespräch fortzusetzen und die konkreten Maßnahmen und Entwicklungen, die zu Kriegen im 21. Jahrhundert führen können, zu diskutieren. Ich freue mich darauf, bald wieder von Ihnen zu hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und erholsame Ruhepausen. Passen Sie gut auf sich auf!
.
Quellen
keine
Kriegsmüde: Leimen / Heidelberg — 01. September 2023
Andreas Kießling, energy design