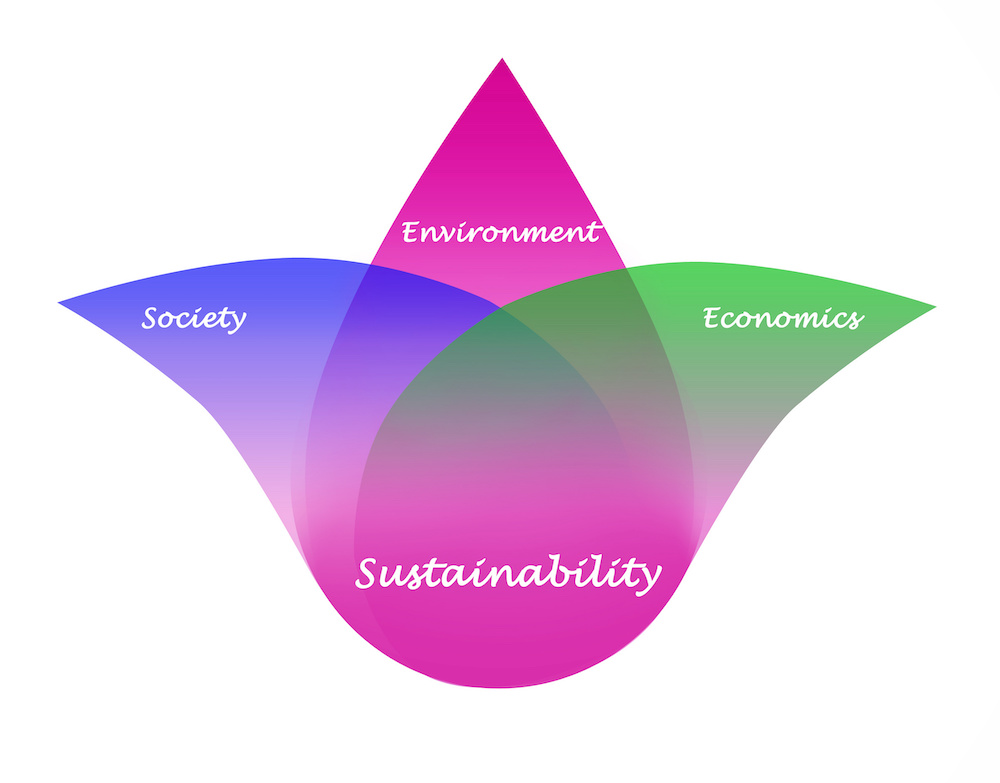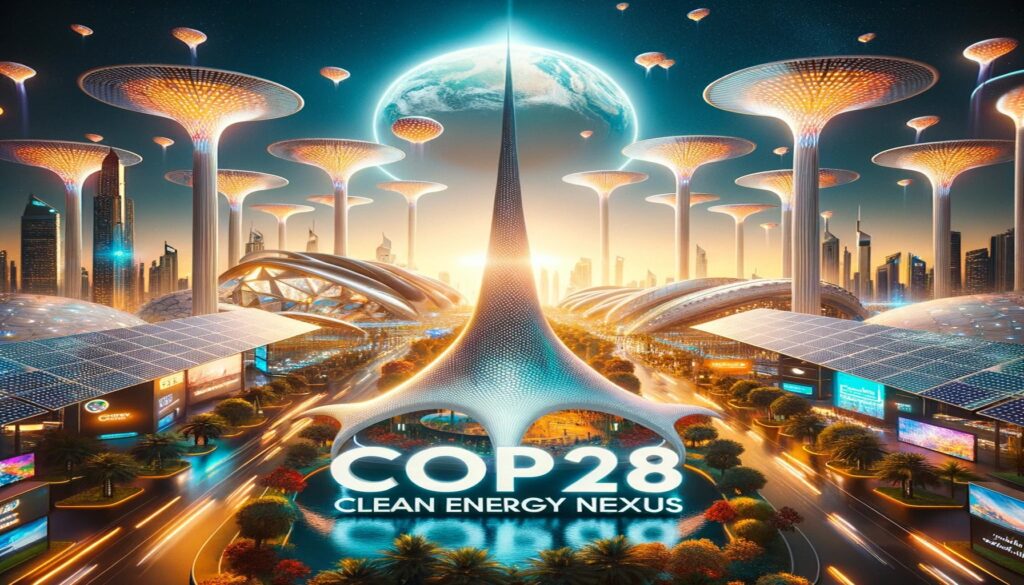Subsidiarität als neues Grundprinzip des Energiesystems
„Die Potenziale der Vor-Ort-Versorgung entfesseln und Subsidiarität als neues Grundprinzip des Energiesystems verankern — in dieser Formel liegt ein wesentlicher Lösungsbeitrag für die anstehende Dekarbonisierung des Energiesystems.“
Pioniere
Das Energiesystem der Vergangenheit war fossil und kerntechnisch getrieben sowie zentral gesteuert. Systemflexibilisierung, Speicher und Digitalisierung spielten eine untergeordnete Rolle. Zukünftig ermöglichen diese Technologien in Verbindung mit integrierten Infrastrukturen von Strom, Wärme und Gas (insbesondere Wasserstoff) das gesicherte Energieangebot.
Noch wichtiger ist aber die Erkenntnis aus Projekten zu Technologien und neuen Märkten sowie zur Digitalisierung des Energiesystems, dass Partizipation der Schlüssel zum Erfolg der Energiewende ist; verbunden mit der Aufgabe, die Bewusstseinsbildung zu Möglichkeiten der Beteiligung voranzutreiben. Arnold Schwarzenegger spricht dazu auf dem Austrian World Summit leidenschaftlich davon, wie Menschen zum Handeln motiviert werden. „Erste Aufgabe zur erfolgreichen Gestaltung des Wandels ist es, Begeisterung auszulösen und Bewusstsein für Chancen zu bilden, um Aktionen zu befördern, anstatt in Furcht vor der Zukunft zu erstarren.“
Erneuerbare Energien bringen Wertschöpfungschancen in Kommunen und ländliche Regionen, autonome Gestaltungschancen für die Menschen im Wohn- und Arbeitsumfeld. Hieraus folgen auch neue Ansätze zum Design nachhaltiger Gebäude und von Lebensräumen sowie für das Zusammenwirken von Menschen in der Gemeinschaft. In einer zunehmend komplexeren Welt wird Globalisierung durch lokales Handeln und Flexibilität ergänzt und Widerstandsfähigkeit bei Gefährdungssituationen erhöht.
Das Projekt C/sells schlägt deshalb zum lokalen und regionalen Handeln im globalen Verbund eine Art zelluläres Energiesystem mit vielfältigen Formen der Partizipation vor. Dies umfasst die Eigenversorgung in Gebäuden, Quartieren sowie auf industriellen oder ländlichen Arealen im Verbund aller Energieträger als auch Erneuerbare Energiegemeinschaften. Daraus folgen neue Chancen für die Stadtwerke als lokale Energiedienstleister und Infrastrukturbetreiber.
Schaut man sich zu dieser Zielstellung das gesellschaftliche Umfeld an, ist festzustellen, dass der Regulierungsrahmen zu wenig Kreativität erlaubt. Es wird ein Rahmen mit mehr Offenheit und Flexibilität benötigt, der es ermöglicht, neue Lösungen auszuprobieren. Das Projekt C/sells im vom Wirtschaftministerium geförderten Schaufenster intelligente Energie (SINTEG) schließt daraus, dass Regulierung von überbordender Bürokratie zu befreien ist und stattdessen Chancen eröffnen und innovative Gestaltung ermöglichen soll.
Subsidiarität als neues Grundprinzip des Energiesystem
Die oben ausgeführten Folgerungen und Empfehlungen des Projektes C/sells lassen sich kaum besser zusammenfassen, als dies von Vertretern des Reiner Lemoine Institutes, des Ökostromanbieters Naturstrom sowie des Fraunhofer-Institutes für Solare Energiesysteme ISE vorgenommen wurde. Deshalb sei an dieser Stelle das nachfolgende längere Zitat erlaubt.
„Die Potenziale der Vor-Ort-Versorgung entfesseln und Subsidiarität als neues Grundprinzip des Energiesystems verankern — in dieser Formel liegt ein wesentlicher Lösungsbeitrag für die anstehende Dekarbonisierung des Energiesystems. Ein solcher Wandel bei der Energieversorgung braucht jedoch zunächst ein politisches Bekenntnis, dass er gewollt ist. Und im zweiten Schritt folgt die Gestaltung. Dafür ergeben sich mit der kommenden Legislaturperiode vielfältige neue Handlungsoptionen. Wir empfehlen die Verankerung dieses neuen Grundprinzips im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung: Das Ziel könnte lauten: Wir setzen uns dafür ein, die lokalen Potenziale der Dekarbonisierung und der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr in Gebäuden und Quartieren zu nutzen. Daher werden wir Lösungen der Vor-Ort-Versorgung als Teil des Energiesystems etablieren. Wir werden prüfen, wie Subsidiarität im Energiesystem umgesetzt werden kann und diese Leitidee im Rahmen der anstehenden Reformen des Energiemarktdesigns berücksichtigen.“
Das Energiesystem war bisher mit seinem zentralistischen Ansatz vorrangig von der internationalen Ebene sowie der nationalen Ebene geprägt. Die Vor-Ort-Ebene bestand ausschließlich aus passiven Endkunden. Der Umbau zu einem nachhaltigen Energiesystem in der benötigten Geschwindigkeit kann nur gelingen, wenn Lösungsbeiträge verteilt und in einer neuen Vor-Ort-Ebene erschlossen werden.
Die Regulierung scheut sich vor der Erschließung dieser komplexen Ebene und behält bestehende regulatorische Rahmenbedingungen bei; baut diese mit einem starken Detaillierungsgrad weiter aus. Dieser Weg wird gerade im Hinblick auf die notwendige Sektorenkopplung von Strom, Wärme, Wasserstoff und Mobilität auf allen Ebenen bis hin in die Stadtquartiere, Gebäude und ländlichen Areale scheitern. Stattdessen sollte Regulierung von Details entschlackt werden und sich auf die grundlegenden Zielstellungen konzentrieren.
Das Papier des Lemoine-Institutes führt dazu unter der Überschrift „Komponentenorientierte Überregulierung überwinden – systemorientierte Regulierung schaffen“ weiter aus: „Technologien zur lokalen Kopplung der Sektoren auf Basis erneuerbarer Energien stehen schon heute bereit und prägen die Marktdiskussionen: Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen, Wallboxen, Speicher, lokale Energiemanagementsysteme oder digitale Steuerung und Zählerinfrastruktur – eine Vor-Ort-Versorgung ist technisch längst möglich und auch bezahlbar. Viele Akteure sind sowohl in der Gebäudewirtschaft – von Eigenheimbesitzern über Wohnungsbaugenossenschaften bis zu großen Immobilienunternehmen – als auch in der Energiewirtschaft in diesen Bereichen bereits tätig. Zu einer systemdienlichen Energieversorgung vor Ort als wichtiges Element des zukünftigen Energiesystems besteht weitgehend Einigkeit. Es fehlen jedoch tragfähige Geschäftsmodelle für eine sektorenübergreifende und effiziente Verknüpfung dieser Technologien. Vor-Ort-Lösungen, Prosumermodelle und Quartierskonzepte boomen in der Diskussion, während ihre Umsetzung vielfach an Hürden der Genehmigungsverfahren und Regulatorik scheitert, nicht aber im eigentlichen Marktgeschehen.“
Koalitionsvertrag und Energie
Doch mit dem Koalitionsvertrag der Ampelkoalition wird erstmalig der beschriebene Ansatz aufgenommen. Grundlage für die Notwendigkeit der beschriebenen dritten Vor-Ort-Ebene ist die Erkenntnis, dass der Umbau des Energiesystems nur bei Partizipation aller gesellschaftlichen Akteure an den Chancen des Wandels gelingen kann. Deshalb ist gemeinwohlorientierten Aspekten besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
Der Koalitionsvertrag führt dazu aus [Bundesregierung. (2021)]: „Wir verbessern die rechtlichen Rahmenbedingungen für gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, wie zum Beispiel für Genossenschaften, Sozialunternehmen, Integrationsunternehmen. … Wir stärken die Bürger-Energie als wichtiges Element für mehr Akzeptanz. Im Rahmen des europarechtlich Möglichen werden wir die Rahmenbedingungen für die Bürger-Energie verbessern (Energy Sharing, Prüfung eines Fonds, der die Risiken absichert) und insgesamt die De-minimis-Regelungen als Beitrag zum Bürokratieabbau ausschöpfen.“
Diese Aspekte sind dabei insbesondere im Hinblick auf die EU-Richtlinien zu Erneuerbaren Energien und zur Umgestaltung des Energiemarktes zu betrachten, die sowohl Eigenversorgung als auch gemeinschaftliche Versorgung, Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften zum Energieaustausch stärken wollen. Anderseits erhöhen dezentrale Gestaltung und Formenvielfalt die Komplexität des Energiesystems. Konzepte zur Komplexitätsbeherrschung umfassen zwingend die autonome Regelung in Teilbereichen des Gesamtsystems bei gleichzeitiger Integration in den Verbund. Dies erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit der Energieinfrastruktur.
Eigenversorgung, gemeinschaftliche Versorgung und Energieaustausch finden vorrangig in Gebäuden statt. Hinzu kommt, dass über 70 % der Umweltbelastung mit Kohlendioxid auf stofflichen Prozessen basiert. Die Energiewende muss deshalb in Zusammenhang mit dem notwendigen Übergang zur Kreislaufwirtschaft betrachtet werden. Gebäude binden einen hohen Teil der Materialien und sind somit im Rahmen der Kreislaufwirtschaft zu bewerten. Energiekonzepte und neue Formen des Bauens wachsen zusammen und führen zu neuen Anforderungen an das Gebäudedesign sowie an die Architekten, Ingenieure und an das Handwerk.
Zur Unterstützung von Stadt- und Raumplanern sowie Gebäudeentwicklern werden Beispiele benötigt, die Kommunen befähigen, vielfältige Formen geschlossener als auch offener Lebensräume mit autonomen Energie- und Stoffkreisläufen und verbindender Infrastruktur zu schaffen. Hierzu besteht ein hoher Experimentierbedarf.
Der Koalitionsvertrag verspricht dazu: „Wir werden ein Reallabor-und Freiheitszonengesetz schaffen, das einheitliche und innovationsfreundliche Rahmenbedingungen für Reallabore bietet und neue Freiräume zur Erprobung von Innovationen ermöglicht. Das Gesetz soll u. a. übergreifende Standards für Reallabore und Experimentierklauseln gesetzlich verankern, die Unternehmen, Forschungsinstituten und Kommunen attraktive Bedingungen bieten und gleichzeitig regulatorisches Lernen fördern. Wir wollen im Rahmen der bestehenden Förderstrukturen auch die Entwicklungsschritte von der Innovation hin zum Markteintritt unterstützen. … Wir fördern die Kreislaufwirtschaft als effektiven Klima- und Ressourcenschutz, Chance für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Arbeitsplätze. Wir haben das Ziel der Senkung des primären Rohstoffverbrauchs und geschlossener Stoffkreisläufe.“
Bauhaus 2.0 als Think Tank für Praktiker sowie Reallabor und Innovationszone
Die Veränderungsprozesse führen zu neuen planerischen Aufgaben für Gebäude- und Quartiersentwickler sowie für Energiekonzepte der Städte und Landschaften der Zukunft. Der Wandel bringt aber auch neue Gefahren für die sichere Funktion der Stadt mit sich. Dies zeigt die zunehmende Anzahl der Cyber-Angriffe aus dem Internet wie auch die aktuelle Corona-Krise. Die Stadt muss sich mit autonomen Funktionen auf diese Gefahren einstellen. In diesem Umfeld sind neue Lösungen zu schaffen, zu demonstrieren und zu vervielfältigen.
Die Stadt der Zukunft kann nicht autark funktionieren. Aber erneuerbare Energien und Dezentralisierung ermöglichen die Entwicklung autonomer, widerstandsfähiger Infrastrukturen mit regionaler und überregionaler Vernetzung.
Architekten und Projektentwickler haben die Aufgabe, Gebäude- und Landschaftsdesign mit der Spezifikation von Energiekreisläufen sowie von notwendigen Digitalisierungsmaßnahmen für autonome Systeme zu verbinden. Aber auch die Einbettung in die Umgebung und die zugehörige Infrastruktur ist zu planen, um die Widerstandsfähigkeit der eigenen Lösung gegen digitale Angriffe einer vernetzten Welt und im Katastrophenfall zu erhöhen.
Zur Bewältigung von Gefahren sowie zur Nutzung neuer Chancen müssen die Kommunen bei der Stadt- und Quartiersentwicklung lernfähig gemacht werden. Dabei sind sowohl Energie und Kreislaufwirtschaft, die Aufgaben der Digitalisierung sowie die soziokulturelle und sozioökonomische Gestaltungsebene der Menschen in ihrem Lebensumfeld zu adressieren.
Vorgeschlagen wird deshalb eine Institution unter dem Arbeitstitel Bauhaus 2.0, die sowohl als Think Tank für Praktiker, als Studio der Lösungsbeispiele zur Verbreitung von Möglichkeiten sowie zum transdisziplinären Austausch wirken kann.
Die Aufgabe besteht darin, Forschung, Hersteller, Energiedienstleister, Handwerk und Bürger transdisziplinär zu verbinden. Es gilt, die im Rahmen von Forschung und Entwicklung neu definierten Gestaltungsmöglichkeiten als Blaupausen dauerhaft zu demonstrieren, in Architektur und das Handwerk zu überführen und somit die vielfältigen Möglichkeiten des zukünftigen Designs der Gesellschaft bewusst zu machen.
Daraus ergeben sich zum Bauhaus analoge Ziele zur transdisziplinären Vernetzung kreativer Geister von Politik und Wissenschaft bis zum Handwerk und zu engagierten Bürgern. Das Ziel besteht in der Entfaltung von Initiativen und Transformationsvorhaben für Energiekonzepte in Verbindung mit Gebäudedesign, Landschaftsgestaltung und Digitalisierung sowie in der Lösungsvervielfältigung.
Quellen:
Bundesregierung. (2021): Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021–1990800 — geladen am 22.02.2022
Lemoine. (2021): Vor-Ort-Potenziale der Energiewende entfesseln — Subsidiarität als neues Grundprinzip des Energiesystems. https://www.reiner-lemoine-stiftung.de/pdf/2021_07_26_White_Paper_Vor_Ort_Konzepte_Subsidiaere_Energiewende.pdf — geladen am 22.02.2022
Andreas Kießling, energy design, Leimen / Heidelberg — 22. 02. 2022