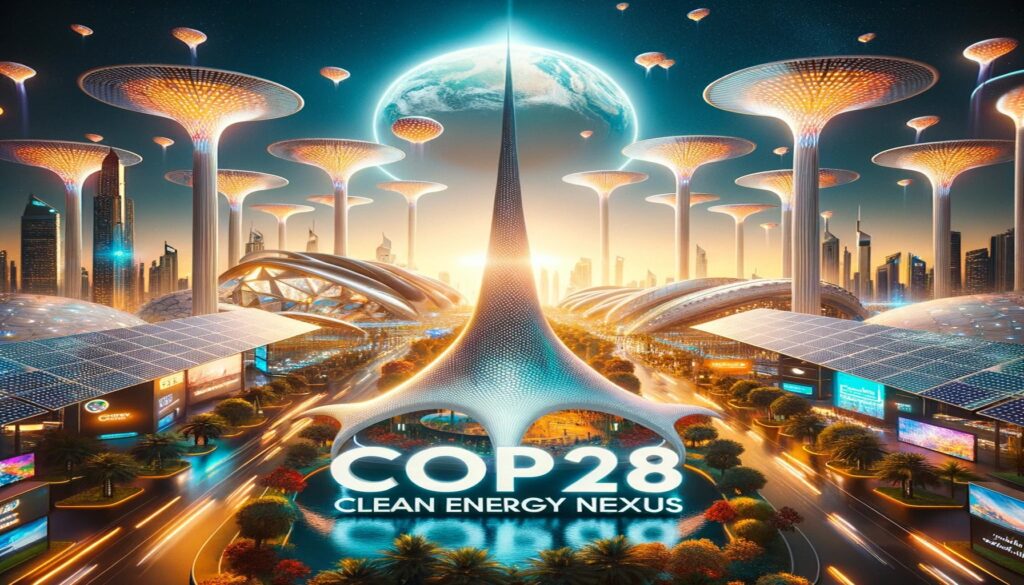Mutlosigkeit
Manchmal scheint sich Mutlosigkeit breit zu machen. Wird es Europa gelingen, in der Zukunft weiter wettbewerbsfähig zu sein? Zwei Beispiele offenbaren schonungslos die aktuelle Problematik. Dabei ergeben sich Schlussfolgerungen für Geostrategie und Energiewende.
Chinesischer Weg
Europa gab in — bei den griechischen Bürgern als Arroganz eingestufter Weise — Direktiven vor, welche staatliche Unternehmen in Griechenland zu privatisieren waren. Damit war die Sache für Europa erledigt, denn es gab weder langfristig tragfähige Ideen noch Untersützung für den Prozess der Privatisierung. Stattdessen folgten immer neue Forderungen, inwiefern Gehälter, Renten und staatliche Subventionsmaßnahmen zu kürzen waren, so dass Arbeitslosigkeit und Armut in Griechenland unfassbar stiegen.
China besetzte die entstehende Lücke der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit. Investoren aus diesem Lande übernahmen den Container-Hafen in Piräus — ein wichtiges Industriezentrum in Griechenland und drittgrößter Mittelmeerhafen. Ein westlicher, allein auf die Wertsteigerung des Unternehmens orientierter Investor hätte nur begrenzte Maßnahmen zur Verwertung des Hafens unternommen. China dagegen denkt geostrategisch. Nicht das Unternehmen oder der Markt ist das alleinige Beurteilungskriterium. Stattdessen sind nationale und internationale Zielstellungen wie Sicherheit, Nachhaltigkeit und globale Einflussmöglichkeiten ebenso Kriterien der Entscheiungsprozesse.
Insofern stellten sich chinesische Investoren, die stets gesamtstaatliche und globale Interessen einbeziehen, gerechtfertigt folgende Frage. Wieso werden die Container aus Asien, die über den Suez-Kanal nach Piräus gelangen, im Hafen auf andere Schiffe umgeschlagen, die dann über das Mittelmeer, die Straße von Gibraltar, den Atlantik, den Golf von Biskaya über die Elbe nach Hamburg gelangen? Die Umweltbilanz hierzu ist vernichtend. Könnten stattdessen die Container in griechischen und italienischen Häfen auf Züge verladen werden, die über den Balkan oder Italien durch Alpentunnel nach Mitteleuropa gelangen? Auf Grundlage dieser Überlegungen treibt China die Konzepte zur Seidenstraße aus der Verbindung neuer See- und Landwege voran und baut in Partnerschaft mit süd- und osteuropäischen Ländern neue Verkehrsinfrastrukturen.
Ergo, China lässt weitgehend Markt zu. Aber Politik ist Herr der Marktentwicklung. Insofern hat ein bewusstes Gestalten des Marktes das Primat gegenüber den materiellen Zielen des Marktes. Dies folgt völlig der Logik östlicher Philosophien.
Die europäische Religion des Marktes
Geostrategisches Denken ist Westeuropa verloren gegangen. Griechenland wurde im Jahre 2009 allein gelassen, aber China wirft man eine Politik zur Spaltung Europas vor. Ein einzelnes Unternehmen kann ein strategisches, länderübergreifendes Projekt nicht vorantreiben. Hier sind die Grenzen der Marktwirtschaft erreicht.
Diese Grenzen werden uns auch mit einem anderen Beispiel nationaler und europäischer Politik verdeutlicht. Zu betrachten ist das Verhältnis von Geostrategie und Energiewende.
Die Energiewende ist in erster Linie ein großer und noch nie dagewesener Prozess der Umgestaltung. Hinter dieser sichtbaren Veränderung der Landschaften und Städte verbirgt sich ein womöglich noch größerer unsichtbarer Prozess des Umlernens. Die als generell sicher geglaubten Lösungsansätze stellen sich nun als die eigentlichen Probleme heraus. Alles befindet sich im Wandel — und mit dem Wandel kommen viele Herausforderungen. Eine Welt der Vielfalt und Differenzen entfaltet sich.
Aber gerade diese neuen, zu gestaltenden Differenzen sind das Problem des Marktes. Der Energiemarkt entwickelte sich über 100 Jahre in zentralistischer Weise mit den Energiequellen in den Händen weniger Industriemonopole. Diese Unternehmen zählten vor der Entwicklung der Technologien zur Computertechnik und dem Internet zu den größten Unternehmen der Welt und sie gehören immer noch dazu. Die damit verbundene Zentralisierung des Marktes und der Systeme zur Übertragung, Verteilung und Lieferung von Energie geschah mit Unterstützung der Staaten. Dies umfasste eine entsprechende geostrategische Ausrichtung mit dem Versuch, den weltweiten Einfluss zu erhöhen. Genau dieses Handeln Europas, das letztendlich seit 500 Jahren auf Basis der Seefahrt und der Kolonialisierung geschah, wirft man nun China vor.
Gleichzeitig ist heute besonders Deutschland unfähig, die Chancen der auf neuer Vielfalt, Differenzen und Digitalisierung beruhenden Energiewende zu erkennen. Der heutige Energiemarkt zeigt sich als ungeeignet, diese Chancen aufzugreifen. Insofern kann man die Energiewende nicht allein den Unternehmen überlassen, sondern muss den Markt in nationaler sowie auch geostrategischer Sicht umgestalten.
Deutschland, die Energiewende und der Markt
Deutschland leitete die Energiewende mit dem Gesetz für Erneuerbare Energien im Jahre 2000 und dann parteiübergreifend mit Fukushima im Jahre 2011 ein. Während die Welt lange auf unseren Weg schaute, übernahm China seit dem Jahre 2015 zunehmend das Heft des Handelns und ist nun globaler Vorreiter der Energiewende. Unfähig zum geostrategischen Wirken befindet sich Deutschland in einer Sackgasse, verweist auf einen Markt, der in ungeeigneter Weise gestaltet ist. Der Rahmen für die bisherigen zentralistischen Akteure wird gepflegt, während die Chancen der Vielfalt dezentraler Akteure übersehen werden. Die grundsätzliche und politisch notwendige Umgestaltung wird unterlassen.
Ergo, Deutschland erhebt die Gestaltungshoheit des Marktes quasi zur Religion und bemerkt nicht, dass die bisherige Marktstruktur nicht mehr geeignet ist. Der Markt ist Herr über die Politik. Seine materiellen Ziele haben das Primat gegenüber den geostrategischen Zielen der Gesellschaft bezüglich der Absicherung unserer Zukunft. Dies folgt völlig der Logik westlicher Philosophien einer primär materiell orientierten Weltsicht, die sich zu einer Art Ersatzreligion entwickelte und das Individuum in den Vordergrund stellt (Trump und „Americas first“ lässt grüßen).
Aktuelle Situation der Energiewende
Eventuell stutzt jetzt der dem Thema geneigte Leser. Entspricht es den Tatsachen, dass in Deutschland die Politik den Markt nicht strategisch gestaltet? Was ist mit der massiven Regulierung des Stromsystems sowie mit den Festlegungen zur Stilllegung von Kraftwerken, zum Netzausbau, zur Deckelung des Ausbaues Erneuerbarer Energien und zur Digitalisierung?
Trotzdem verfehlen wir alle europäisch oder national gesteckten Ziele zum Umbau des Energiesystems. Der Ausstoß an Kohlendioxid verringert sich in Deutschland nicht. Das Tempo beim Zubau erneuerbarer Energieanlagen geht stetig zurück, womit die Ausbauziele für 2030 und 2050 gefährdet sind. Die Energieeffizienz im Land, insbesondere im Bereich der Gebäude und der Industrie sowie im Verkehr erhöht sich kaum, um die Ziele für 2050 zu erreichen. Gleichzeitig steigen ununterbrochen die Energiepreise für Bürger und Unternehmen. Bei den Energiepreisen bewegen wir uns international im Bereich der Spitzenreiter, ohne dass wir ausreichend Erfolge vorweisen können. Die Versorgungssicherheit ist weiterhin hoch. Doch die Anzahl der notwendigen Eingriffe der Übertragungsnetzbetreiber beim Ausbilanzieren von Energiegewinnung und Energienutzung steigt dramatisch. Mehrfach standen wir am Rande der Katastrophe zum Blackout. Was ist hier los?
Letztendlich spielen genau zwei Faktoren zusammen.
Faktoren des Misserfolges
Dargestellt wurde, dass im europäischen Handeln der Markt das Primat besitzt. Dies wirkt ebenso im Aktionismus der Politik bezüglich der Gestaltung der Energiewende.
Der erste, die erfolgreiche Energiewende behindernde Faktor ist folgender Tatsache zu verdanken. Trotz zunehmenden Ausbaus dezentraler Energien wurde die Beherrschung des Gesamtsystems zur Energieinfrastruktur durch wenige führende Marktakteure nicht aufgegeben. Regulierung und Gesetzgebung gestalten Maßnahmen zum Umbau des Energiesystems derartig, dass das System bisheriger Marktakteure erhalten bleibt. Dies zeigt sich bei zu langfristig angelegter Stilllegung fossiler Kraftwerke und beim Netzausbau. Regionale Marktaktivitäten, Bürgergenossenschaften und Anlagen zur Eigenverbrauchserhöhung in Gebäuden und Stadtgebieten werden behindert. Dies trifft auch auf den Unwillen der Politik zu, regionale Energieausgleiche mit Energiespeichern und in Verbindung von Energieinfrastrukturen zu Strom, Wärme, Gas und Mobilität zu fördern.
Politik wird vom bisherigen Markt beeinflusst und ist unfähig, die Chancen aus der Verbindung von Infrastrukturen mit globalem, kontinentalem, nationalem, regionalem und lokalem Kontext zu erkennen. Der bisherige Markt funktioniert für die nachhaltigen Energiekreisläufe der Zukunft nicht mehr und muss neugestaltet werden. Dies erfordert geostrategisches Denken und damit das Primat der Politik über den Markt.
Der zweite, die erfolgreiche Energiewende behindernde Faktor liegt in der Detailverliebtheit der Administration unseres Staates.
Seit 12 Jahren hält sich die Politik – mit einer Gesetzesnovelle im Jahre 2007 und weitergeführt mit dem Auftrag an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik im Jahre 2010 – an der detaillierten Spezifikation und Zertifizierung eines intelligenten Messsystems fest. Gleichzeitig werden vielfältig notwendige Maßnahmen zur Führung eines volatileren und dezentraleren erneuerbaren Energiesystems an der Verfügbarkeit dieser Messsysteme festgemacht. Neue Gestaltungsformen für alle Akteure der Gesellschaft, die die Energiewende potenziell ermöglicht, werden damit verhindert. Damit unterliegen deutsche Unternehmen der Gefahr, dass auch hier die handelnden Akteure zukünftig auf Basis der Digitalisierung aus China oder auch den USA kommen.
Staatliche Detaileingriffe oder Gestaltung des Rahmens
Offenbar verhindert Detailverliebhtheit bei gleichzeitiger Priorisierung des existierenden Marktes die notwendige Verbindung von Geostrategie und Energiewende.
Das Thema der Detaileingriffe soll deshalb noch einmal am Beispiel der intelligenten Messsysteme aufgenommen werden. Mit dem im Jahre 2011 gestarteten und acht Jahre anhaltenden Prozess zu deren Definition wurde in Deutschland der technische Rahmen bis zur Zertifizierung erster Hersteller im Detail durch eine vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) beauftragte Behörde gestaltet. In der Folge ist Deutschland in Europa inzwischen bei der Einführung Klassenletzter. Einige, potenzielle Geschäftsmodelle kamen durch den Konkurs zu lange in Warteposition gesetzter, junger Unternehmen nicht zur Wirkung. Die von höchster Geschwindigkeit geprägte Welt der Informationstechnologien produzierte in diesem Zeitraum mehrere Gerätegenerationen.
International ist ein völlig anderes Vorgehen üblich.
Der Staat definiert technologieoffen grundsätzliche Anforderungen und übt damit das Primat seiner Gestaltungshoheit aus. Der Markt sorgt jeweils für die aktuell beste technische Lösung, die konform zu den Anforderungen ist. Dies macht den Erfolg amerikanischer Internetunternehmen aus, die mit agiler Entwicklungsgeschwindigkeit auf jeweils neue Anforderungen eingehen. Dies beschreibt auch die Vorgehensweise Chinas, bei der der Staat an grundlegenen Entscheidungsprozessen der Unternehmen beteiligt ist, aber gleichzeitig die Handlungsmöglichkeiten des Marktes weitgehend ermöglicht.
Das nationale Vorgehen Deutschlands ist in hohem Maße durch Regulierung, Gesetzgebung sowie auch von Standardisierung und technischen Vorgaben im Detail geprägt. Das BMWi stellte aktuell einen Fünf-Jahres-Plan zur Weiterentwicklung des intelligenten Messsystems und der notwendigen Normen für Kommunikation und Sicherheit der Öffentlichkeit vor. Böswillige Akteure könnten hier Vergleiche zur Detailverliebtheit osteuropäischer Fünf-Jahres-Pläne vor der politischen Wende im Jahre 1990 ziehen.
Dagegen stellt China ebenso Fünf-Jahres-Pläne auf, die auch den Umbau des Energiesystems einschließen. Doch hierbei wird auf den Rahmen, grundsätzliche Zielstellungen unter Einbeziehung der Aspekte Geostrategie und Energiewende geachtet. Detailverliebtheit würde das Vorhaben an der resultierenden Komplexität der Führung zerbrechen lassen.
Herausforderungen zur Festlegung des Rahmens
Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen bringt neue Herausforderungen mit sich. Dies betrifft insbesondere die notwendige Systemflexibilisierung im Sektorenverbund Strom, Wärme, Gas und Mobilität, um die Schwankungen der Energiegewinnung zu beherrschen.
Damit verbunden sind die Zunahme der Vielfalt aktiver Beteiligter und deren Grad der Vernetzung, aber auch das Entstehen neuer Formen der Organisation zwischen den Beteiligten. In der Folge wächst die Komplexität der Systemführung.
Die Vielfalt resultiert aus der Anwendbarkeit der erneuerbaren Erzeugung in unterschiedlichster Skalierung vom Gebäude über Stadtquartiere und Areale, über Ortschaften, Städte zu Regionen, bis hin zu nationalen und internationalen Strukturen.
Beim ausschließlich zentral gesteuerten System unter den Bedingungen der Vielfalt der Beteiligten kann Komplexität zur Unbeherrschbarkeit des Systems führen. Autonomie vielfältiger und verbundener Teilsysteme ohne Regeln der Interaktion kann zu chaotischem Verhalten führen. Die Kunst eines stabilen und gleichzeitig flexiblen sowie entwicklungsfähigen Systems besteht darin, lokal als eigenständiges System zu agieren, aber gleichzeitig die Synergien einer globalen Vernetzung zu erschließen – handle lokal und denke global.
Der Satz der Mechanismen innerhalb von Teilsystemen als auch die Regeln an den Grenzen zwischen den Teilsystemen, die Autonomie ermöglichen und gleichzeitig ein flexibles Gesamtsystem fördern, sind demzufolge zu definieren.
Dieser Satz von Regeln ist primär durch die Gesellschaft und den Staat als Vertreter vorzugeben, beschreibt aber lediglich die grundsätzlichen Anforderungen. Es ist nicht zielführend, technische Lösungen detailliert durch den Staat vorzugeben. Hier kann technologieoffen der Markt sekundär in den Grenzen des Rahmens agieren.
Wir haben aber auch festgestellt, dass die Grenzen zwischen staatlicher Einflussnahme und Agieren des Marktes fließend sind — wie bei aller Dialektik. Insofern kann folgende Schlussfolgerung gezogen werden. Zu berücksichtigen sind sowohl geopolitische und als auch lokale, regionale Aspekte. In Bezug auf das Verhältnis von Geostrategie und Energiewende sind aber ebenso die Maßnahmen von Staat und Markt auszutarieren.
Zelluläre Gestaltung im Verhältnis von Geostrategie und Energiewende
Ein Energiesystem kann schon innerhalb eines Gebäudes definiert werden. Im Verbund können diese Gebäude miteinander interagieren sowie Energie teilen und austauschen.
Gebäude können wiederum Teil eines Stadtquartieres sein, in dem gemeinsame Energieanlagen und andere Infrastrukturen bereitstehen sowie zur Nutzung durch alle Beteiligten gesteuert werden. Damit entsteht letztendlich ein gemeinsames System, in das Teilsysteme eingebettet werden, die als Energiezellen eines Gesamtsystems betrachtet werden können.
Die Einbettung von Energiezellen in umfassendere Zellen kann folgendermaßen typisiert werden:
- Wohnhäuser und kommerzielle Gebäude
- Stadtquartiere
- Industriegebiete sowie andere private und öffentliche Areale
- Verteilungsnetze und sonstige Nahnetze
- Übertragungsnetze und sonstige Fernnetze
- Verbundnetz in Europa
- interkontinentaler Verbund
Somit kann ein Energiesystem auf Basis eingebetteter Energiesysteme gestaltet werden. Die eingebetteten Systeme bilden Energiezellen eines Gesamtverbundes als zelluläres Energiesystem mit dem Begriff Energieorganismus als Analogie.
Hierbei lassen sich die geopolitischen Ziele Chinas beim Aufbau neuer transkontinentaler Infrastrukturen als weltumspannendes Stromnetz ebenso integrieren wie kontinentale, nationale, regionale und lokale Lösungen. Subsidiäres Handeln und Globalisierung wachsen zusammen. Menschen in den verschiedenen Kulturen und Gesellschaften behalten Handlungshoheit und nutzen trotzdem die Vorteile des Zusammenwirkens.
Schlussfolgerungen
Dargestellt wurde, dass die richtige Gestaltung des Verhältnisses von Geostrategie und Energiewende durch die Politik aufgrund regionaler, nationaler und geopolitischer Aspekte sowie durch den Markt aufgrund individueller, monetärer Aspekte im Widerstreit von zentralen und dezentralen Akteuren kein leichtes Unterfangen ist.
Grundsätzlich aber gilt es, das Primat der Gesellschaft und damit des bewussten Gestaltens aufgrund der Interessen der Menschen als Gemeinschaft gegenüber der sekundären Funktion des Marktes zu bewahren.
Die Wirtschaft befindet sich in der dienenden Funktion gegenüber der Gesellschaft!
Nicht die Gesellschaft dient der Wirtschaft!
Dementsprechend ist eine Wirtschaft zu gestalten, die die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten im Verhältnis von Subsidiarität und Globalisierung bewahrt und damit auch das Spannungsfeld von Geostrategie und Energiewende beherrscht.
Andreas Kießling, Leimen, 31. März 2019