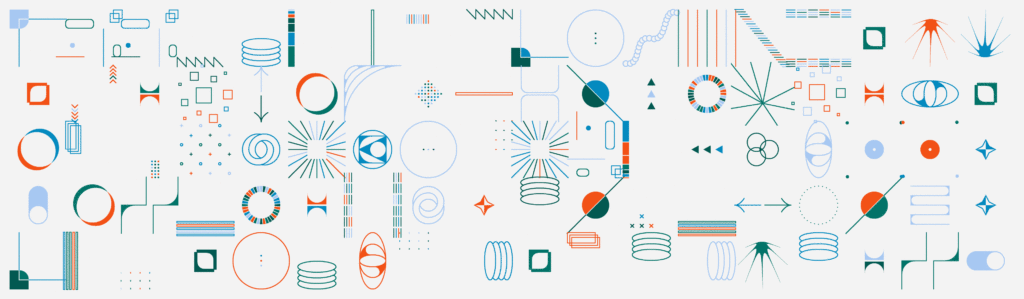Plädoyer für neuen Gesamtentwurf zum Energiesystem der Zukunft
Wissen um den Energiebedingten Klimawandel
Achtzig Prozent der Kohlendioxidemissionen sind energiebedingt. Bei den Anstrengungen gegen den Klimawandel wird somit der Fokus auf die Art und Weise der Gewinnung und Nutzung von Energie verständlich. Sonne und Wind bieten aktuell die größten Potenziale für den notwendigen schnellen Wandel. Dazu besteht in der Politik weitgehend Konsens. Schwieriger wird die Einigung bei der Bestimmung des Weges.
Untrennbarkeit des Ausbaus Erneuerbarer Energien mit Sektorkopplung und Energieeffizienzmaßnahmen
Mit den Forschungsprojekten seit dem Jahre 2010 wurde der Bedarf zur Kopplung der Energiesektoren deutlich, um die notwendige Flexibilität im erneuerbaren Stromsystem zu gewährleisten. Hinzu kommt, dass zwar die direkte Nutzung von Strom am energieeffizientesten ist, aber nicht mit Elektrizität zu deckende Bedarfe verbleiben.
Dagegen ist bei politischen Entscheidungen das Bewusstsein um die Notwendigkeit sektorübergreifender Rahmenbedingungen bezüglich Elektrizität, Wärme und Gas sowie deren Nutzung in Gebäuden, in Gewerbe und Industrie, im Verkehr, in der Landwirtschaft oder — im globalen Maßstab – zur Meerwasserentsalzung noch nicht ausreichend verbreitet.
Ebenso kann die notwendige Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen im notwendigen Tempo allein durch den Ausbau Erneuerbarer Energien nicht gelingen. Insofern kommt der Steigerung der Energieeffizienz eine ebenso hohe Bedeutung zu. Allein durch die Dezentralisierung bei der Nutzung Erneuerbarer Energien können 760 TWh Umwandlungsverluste eingespart werden. Wärmepumpen besitzen das Potenzial den Energiebedarf im Wärmesektor um 550 TWh zu verringern. Hinzu kommt das Einsparvermögen in Höhe von 310 TWh im PKW-Verkehr durch Elektromobilität.
Potenzialgrenzen sowie Komplexität der Aufgaben und Technologielösungen erfordern Lösungsoffenheit
Bei aller Begeisterung für den direkten Einsatz von Strom werden in der Gesamtbetrachtung des Energiebedarfes von Städten, Industriebetrieben und im Verkehr schnell Grenzen ersichtlich. Beispielsweise benötigt industrielle Prozesswärme eine komplexe Betrachtung des Einsatzes von Biomasse, Abwärmerückgewinnung, Wärmepumpen und Solarthermie. Die Komplexität von Heizung und Kühlung bei Wohn- und Gewerbeobjekten sowie Stadtquartieren und ländlichen Siedlungen steigt mit erneuerbaren Energiekreisläufen ebenso.
Bestandteil der Sektorenkopplung ist auch die energetische Nutzung von Biomasse, aber deren Nutzung befindet sich in der Flächenkonkurrenz zur Lebensmittelproduktion.
Die Grenzen der direkten Nutzung von Strom werden ebenso beim Flug- und Schiffsverkehr sowie beim LKW-Fernverkehr ersichtlich. Hier wird die Umwandlung von Strom in Wasserstoff benötigt. Die Bedarfe zur Nutzung von Wasserstoff als Energieträger bestehen aber insbesondere in der Zementproduktion, in der Grundstoffindustrie sowie bei der Eisen- und Stahlproduktion. Dabei ist aus Effizienzgründen genau abzuwägen, wo der Einsatz von Wasserstoff sinnvoll ist und wo nicht. Schnell werden in der Diskussion fiktive Bedarfe zum Wasserstoffeinsatz in Gebäuden und beim Verkehr generiert. Der Einsatz von Wasserstoff ist deshalb sehr differenziert zu bewerten.
Bei globaler Sicht auf das Energiesystem gehört auch der Energieeinsatz zur Meerwasserentsalzung dazu. Damit ist quasi alles mit allem verbunden. Gekoppelt sind die Themen Klimaschutz, bezahlbarer Zugriff auf Energie, Flächenkonkurrenz zwischen Lebensmitteln und Energiegewinnung, Wassergewinnung, nachhaltige Gestaltung von Städten und Gemeinden, Umbau von Industrie und Infrastrukturen sowie das Verhältnis von Konsum und Produktion.
Neuer Gesamtentwurf mit Speichertechnologien, Dezentralität und Entbürokratisierung
Hinzu kommt in diesem Umfeld der vielfältige Bedarf an unterschiedlichsten Speichertechnologien. Das Energiesystem der Vergangenheit war fossil und kerntechisch getrieben und zentral gesteuert. Speichertechnologien spielten eine untergeordnete Rolle. Zukünftig ermöglichen erst diese Technologien in Verbindung mit dem Sektorenverbund das gesicherte Energieangebot.
Das daraus resultierende System mit vielfältigen Querbeziehungen und zirkulären Prozessen lässt sich in seiner Komplexität nicht mehr zentral umfassend planen sowie politisch im Detail vordenken.
Benötigt wird ein neuer Gesamtentwurf als Leitbild für das Energiesystem der Zukunft.
Das Projekt C/sells sowie der VDE-Fachausschuss „Zelluläre Energiesysteme“ schlagen sowohl eine zelluläre Architektur des Energieverbundes vor als auch einen entschlackten Rahmen, der mit Zielgrößen arbeitet. Dieser Rahmen ermöglicht weitgehend technologieoffen die Eigengestaltung in Zellen verschiedener Typen. In C/sells wurde dieses Konzept in Zellen verschiedener Größenordnungen als Gebäude, Stadtquartiere, ländliche und gewerbliche Areale, Städte und Regionen im Sektorenverbund demonstriert.
Diese Zellen schließen für den Entscheider in der Politik einen Teil der Komplexität des Gesamtsystems in autonomen Teilen ein. Sie ermöglichen vielfältige Gestaltung statt Detailregulierung. Diese Teile wirken durch gemeinsame Regeln und Standards im Verbundsystem zusammen. Die Regeln basieren dabei auf gemeinsamen Zielgrößen für Dezentralisierung, Defossilisierung, Digitalisierung und Demokratisierung. Diese Ziele sind mit Anforderungen zur Partizipation, Versorgungssicherheit, CO2-Reduktion und Wirtschaftlichkeit zu verbinden.
Diese Kopplung von Autonomie und Verbund benötigt die Flexibilität der Teilsysteme — den Zellen — als eine Art virtuelle Speicher mit zeitlich variablem Verhalten. Kernbestandteil dieser Zellen sind autonome Energiekonzepte und dezentrale Energiegewinnung, der digitale Netzanschluss mit Smart Grid Gateway und lokalem Energiemanagementsystem.
Abbau von Bürokratie und Bauhaus 2.0 als Think Tank für Praktiker
Welchen Rahmen sollte nun Politik auf Grundlage welcher Zielstellungen und Anforderungen gestalten? Wie gelangt das Bewusstsein für Handlungsoptionen in die Breite der Gesellschaft?
Es ist notwendig, dass Politik erkennt, dass weniger technische Detailregulierung, Abbau von Bürokratie sowie Entschlackung von Gesetzen und Regularien mehr im Ergebnis beim Umbau des Energiesystems sein kann. Vorrangig sollte es politischen Entscheidungsträgern darum gehen, auf Grundlage gemeinsamer Ziele sowie eines gemeinsamen Rahmens Handlungsoptionen für alle Akteure der Gesellschaft zu verbreiten. Dabei sind sowohl die energietechnische Ebene, die Aufgaben der Digitalisierung, der Energiemarkt sowie die soziokulturelle und sozioökonomische Gestaltungsebene der Menschen in ihrem Lebensumfeld zu adressieren.
Vorgeschlagen wird deshalb eine Institution unter dem Arbeitstitel Bauhaus 2.0, das sowohl als Think Tank für Praktiker, als Studio der Lösungsbeispiele zur Verbreitung von Möglichkeiten sowie zum transdisziplinären Austausch wirken kann.
Andreas Kießling, energy design, Leimen / Heidelberg — 21. September 2021