Notwendigkeit eines neuen Masterplans
Die Randbedingungen haben sich grundlegend geändert
Der Krieg in der Ukraine veränderte die Rahmenbedingungen zum Umbau des Energiesystems in Europa, aber insbesondere in Deutschland, in einer nie gekannten radikalen Weise. Die Gasbrücke in die nachhaltige Energiezukunft existiert nicht mehr in der kostengünstigen, bekannten Form. Daraus resultiert die Notwendigkeit eines neuen Masterplans für das zukünftige Energiesystem Deutschlands. Trotz dieser Veränderungen dürfen aber die dezentralen Chancen des Umbaus für Bürger, Unternehmen, Kommunen und Regionen nicht vergessen werden. Diese Chancen widmet sich der Vorschlag zur Errichtung eines „Energy & Living Lab“ als Reallabor der Energiezukunft zur transdisziplinären Zusammenarbeit. — Kommentare unten oder auch gern auf Telegram unter t.me/energy_design )
Cui Bono?
Die Sprengung von Nordstream, der Gasverbindung zwischen Deutschland und Russland, bisher quasi die Halsschlagader im Energiekreislauf Deutschlands, nützt nur der USA. Damit wird endgültig die Energie-Abhängigkeit von Russland durch die Abhängigkeit von den USA ersetzt. Der Unterschied ist, dass Gas mit niedrigsten Vorketten-Emissionen und niedrigen Preisen nun durch Flüssiggas (LNG) mit höchsten Emissionen sowie zu “Mondpreisen” — wie es selbst Robert Habeck ausdrückt — ersetzt wird.
Diese neue Abhängigkeit von den USA gilt es ebenso zu durchbrechen, um in Deutschland Energie-Souveränität zurückgewinnen, indem wir Erdgas weitgehend überflüssig machen.
Dazu gehören Projekte mit Wind- und Solarenergie, wie in der Heimat des Autors, der Lausitz. https://www.pv-magazine.de/2022/10/04/weitere-80-megawatt-photovoltaik-leistung-im-energiepark-lausitz-am-netz/?
Dazu gehört aber auch die Technologieoffenheit für einen neuen Energiemix und die Sektorenkopplung, was die Resilienz gegenüber verschiedenen Risiken, aber insbesondere die Autonomie Deutschlands und seiner Regionen sowie auch die zeitweise Autarkie im Notfall erhöht.
Für die Technologieoffenheit und die notwendige Vielfalt eines autonomen Energiesystems reicht es nicht, nur den Blick auf den Wind und die Sonne zur richten. Gleichzeitig ist die sogenannte Gasbrücke auf dem Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem schnellstens von fossilem Erdgas auf Wasserstoff umzustellen. Dies zeichnet auch das Projekt in der Lausitz aus.
Eventuell müssen wir auch unsere Scheuklappen ablegen und neue Technologien zur Kernspaltung betrachten, die keine Endlagerung benötigen und keine überkritischen Zustände mit der Gefahr der Explosion kennen, womit zwei der Hauptgründe für die Ablehnung von Kernkraft, die ich persönlich als Kernphysiker auch vertreten habe, entfallen. Es ist interessant, dass mögliche überkritische Zustände in Kernkraftwerken nur eine Folge des kalten Krieges und des Vorrangs der Entwicklung von Kernwaffen sind. Es war einfach zu teurer, Kernwaffen und Kernkraftwerke mit unterschiedlichen Technologien zu entwickeln. Ich werde mich in den nächsten Tagen im Blog „Energieorganismus“ diesem Thema widmen. Hinzu kommen die notwendigen weiteren Forschungsanstrengungen zur Kernfusion.
Aber auch neue Technologieansätze zur Energiegewinnung im Experimentalstatus sollten nicht vorschnell auf das Abstellgleis geleitet werden.
Innovationen und Technologieoffenheit haben das Wirtschaftswunder und die Stärke Deutschlands bewirkt. Ein aktuell zu verzeichnender Hang zur technischen Detailregulierung, zur ideologiebesetzten Ablehnung von Lösungen, zum eingeschränkten Denken und belehrenden Handeln der Politik wird auf Dauer Deutschland schwächen.
Persönlich bin ich sehr an der Meinung unterschiedlicher Denkschulen interessiert. Wir werden unterschiedlicher Meinung sein, aber besser ein kultivierter Streit als Sprachlosigkeit. Mein Anliegen ist es, den größten gemeinsamen Nenner zu suchen. Der kleinste gemeinsame Nenner bringt unsere Gesellschaft nicht weiter. https://energieorganismus.de/politikeinblicke
Meine Schlussfolgerungen für die Smart Grids-Roadmap Baden-Württemberg mit der Notwendigkeit eines neues Masterplans sind nachfolgend mit drei Schwerpunkten zusammengefasst.
Schlussfolgerungen für die Smart Grids-Roadmap Baden-Württemberg
Notwendigkeit eines neuen Masterplans
Ein Hauptergebnis hatten sowohl das von BMWi und BMU geförderte E‑Energy-Programm in den Jahren 2008 bis 2013 als auch das vom BMWi geförderte SINTEG-Programm von 2018 bis 2022 gemeinsam. Allein mit Erneuerbarer Stromerzeugung auf Basis von Solar- und Windanlagen steht nicht zu jeder Zeit genügend Energie zur Verfügung. Geschlussfolgert wurde, dass die Kopplung zwischen allen Energiesektoren benötigt wird und dabei nur Gas die notwendige Flexibilität für wochenlange “Dunkelflauten” bieten kann. Hinzu kommen grundlastfähige Wasserkraftwerke und Pumpspeicherwerke in Norwegen sowie in den Alpen als auch die entsprechende Stärkung des europäischen Netzverbundes.
Insbesondere die hohen Flexibilitätspotenziale aus dem Gasnetz und den Gasspeichern prägten den Begriff Gasbrücke in die Zukunft der Erneuerbaren. Ein bis zwei Jahrzehnte später sollte dann die Gasbrücke auf Basis von Erdgas durch Wasserstoff ersetzt werden. Dies begründete auch die Intensivierung der Gasbezüge aus Russland. Wenn nun die Brücke nach Russland abgebrochen wird und durch eine Gasbrücke per LNG in die USA verlagert wird, wird dies für das Gesamtsystem um ein Vielfaches teurer. Billiges Gas aus Russland war kein aus Wohlstandsdenken Deutschlands resultierender Egoismus, wie oft in den Medien oder auch durch Politiker dargestellt. Im Gegenteil war der Bau dieser Brücke eine Notwendigkeit für den Beitrag Deutschlands im Kampf gegen den Klimawandel. Alle Simulationen zum Energiesystem in Deutschland bis 2040 basieren auf billigem Gas inklusive des langfristigen Wechsels zu Wasserstoff. Aber die Randbedingungen haben sich nun grundlegend geändert, das heißt Studien mit kombinierten Vorhersagen zur Erzeugungssituation sowie zur Markt- und Netzentwicklung sind nicht mehr aktuell.
Deswegen stellt sich insbesondere im Prozess der Erstellung der Smart Grids-Roadmap in Baden-Württemberg die Frage, wie das neue Gesamtkonzept zum Energiesystem aussieht. Die Entwicklung seit der ersten Version zur Smart Grids-Roadmap entsprach grundsätzlich den Prognosen. In einer zweiten Roadmap kann aber nicht zur Tagesordnung auf Basis bisheriger Erkenntnisse übergegangen werden. Es werden weitere Überlegungen und Simulationen benötigt, um neue Zukunftsszenarien in die Festlegung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten eingehen zu lassen. Benötigt wird ein neuer Masterplan für die Energiezukunft in Baden-Württemberg, der natürlich auch auf angepassten, nationalen und europäischen Vorgehensweisen beruhen muss.
Die stärkere Auslastung der Kohlekraftwerke und teures Gas aus den USA mit den höchsten Vorketten-Emissionen kann nicht die Lösung sein. Bis zur breiten Verfügbarkeit von Wasserstofftechnologien und von Wasserstofflieferungen auf Basis erneuerbarer Energiegewinnung vergehen noch rund zehn Jahre. Für Kernenergie auf Basis der Kernspaltung scheinen sich weiterhin keine Mehrheitspositionen zu finden. Sicherlich benötigen wir aber eine breite offene Diskussion über das zukünftige Energiesystem, das eher nicht mehr von der Gasbrücke getragen wird.
Mehr Innovation — weniger technische Detailregulierung
Der zunehmende Grad der digitalen Vernetzung zur Beherrschung volatiler, dezentraler und erneuerbarer Energiegewinnung sowie der notwendigen Sektorenkopplung erfordert die Nutzung einer sicheren Kommunikationsinfrastruktur für Mess- und Steuerungsprozesse. Dabei war es ein richtiger Schritt, dafür eine gemeinsame Infrastruktur für alle Markt- und Netzakteure mit intelligenten Messsystemen anzustreben. Die Umsetzung wurde aber in einem zu hohen Grad vom Rechtssystem detailliert vorgedacht. Dies führt zu Einschränkungen bei der Umsetzbarkeit von Innovationen. Ebenso bestehen Konflikte mit internationalen Normen, die die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Unternehmen im internationalen Umfeld behindern können.
Insofern wird deshalb empfohlen, dass das Land Baden-Württemberg im Bundesrat darauf hinwirkt, dass der Gesetzgeber sich auf allgemeine Schutzanforderungen zur Gewährleistung grundlegender Rechtsprinzipen und Schutzrechte (z. B. Datenschutz, Datensicherheit, Schutz kritischer Infrastrukturen, Schutz des Wettbewerbs) zurückzieht. Es werden Innovationsimpulse statt Detailregulierung gefordert. Der Industrie sollte die Umsetzung der Anforderungen auf Grundlage einer europäischen und internationalen normativem Basis überlassen werden. Dabei ist Regulierung dahingehend auszurichten, dass Innovationen und technologische Entwicklungen befördert und nicht durch eine zu starre technische Detailregulierung gehemmt werden.
Deshalb ist auch der neue Ansatz im §14a des Energiewirtschaftsgesetzes zu unterstützen. Das Konzept basiert auf einem Sollwert-Konzept am Stromnetzanschlusspunkt (NAP). Die Idee ist, dass der Verteilnetzbetreiber nach vertraglicher Vereinbarung mit Anschlussnutzern zur sicheren Netzführung Sollwerte für Bezug und Einspeisung am NAP vorgeben kann. Betreiber oder Nutzer von Liegenschaften können damit den sicheren Netzbetrieb aktiv unterstützen. Statt eines technischen Durchgriffs auf einzelne steuerbare Geräte oder Anlagen (z.B. PV-Anlage, Speicher, Wärmepumpe, Ladeeinrichtung für Elektromobilität) überträgt der Netzbetreiber die Verantwortung an den Anschlussnutzer. Dieser hält die Leistungsgrenzen am Netzanschluss über das eigene Energiemanagement-System durch Ausnutzung der Flexibilität aller technischen Gebäudeeinrichtungen im Sektorenverbund ein.
Energy & Living Lab — Reallabor der Energiezukunft
Das zukünftige Energiesystem ist von zunehmender Komplexität geprägt, aber bietet damit gleichzeitig lokale Chancen zur autonomen Eigengestaltung durch Bürger, Unternehmen und Kommunen in ihrem jeweiligen Lebensumfeld. Für das Gebäudedesign sowie die Stadt- und Landschaftsentwicklung ergeben sich neue Möglichkeiten. Neue Berufsbilder im Handwerk entstehen.
Es gilt, die vielfältigen Möglichkeiten zur Gestaltung der Energiewende auf Basis integrierter Methoden und Werkzeuge der Gesellschaft bewusst zu machen — in Anlehnung an die Bauhaus Idee. Daraus ergeben sich analoge Zielstellungen zur
- transdisziplinären Vernetzung kreativer Geister als Ideenfabrik für Energiekreisläufe,
- Einordnung singulärer Beiträge in das Gesamtsystem komplexer Infrastrukturen,
- Bereitstellung von Experimentierumgebungen,
- Übertragung der Experimentierbeispiele in reale Umgebungen,
- Präsentation von Mustern für Architektur und Handwerk als auch Darstellung neuer Möglichkeiten für die breite Öffentlichkeit sowie
- Unterstützung der weltweiten Verbreitung der Konzepte und Beispiele.
Es wird deshalb vorgeschlagen, eine Initiative zur Gründung eines „Energy & Living Lab“ als dauerhaft installiertes Reallabor der Energiezukunft und Forum für den Austausch von Lösungen, deren Massenfähigkeit befördert werden soll, zu unterstützen.
Dabei ist auch die Umsetzung der Digitalisierung beispielhaft zu konzipieren, zu gestalten und zu demonstrieren sowie das Erleben interaktiv zu ermöglichen, die Vervielfältigung zu befördern und die transdisziplinäre Zusammenführung zu befähigen.
Weiterhin werden die traditionellen Prinzipien der Energieversorgung im Lichte des bevorstehenden Umbaus der Energieinfrastruktur auf den Prüfstand gestellt. Innovationen, die autonome und verbundene Energiekreisläufe als Bestandteil von Gebäude‑, Stadt- und Landschaftsgestaltung betrachten, sollen befördert werden.
Leimen / Heidelberg — 07. Oktober 2022
Andreas Kießling, energy design



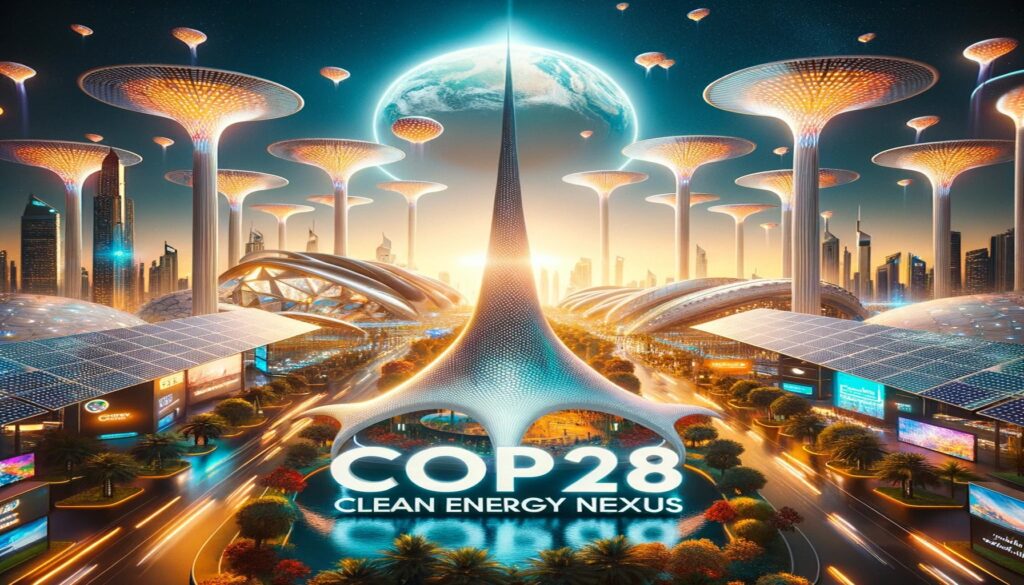
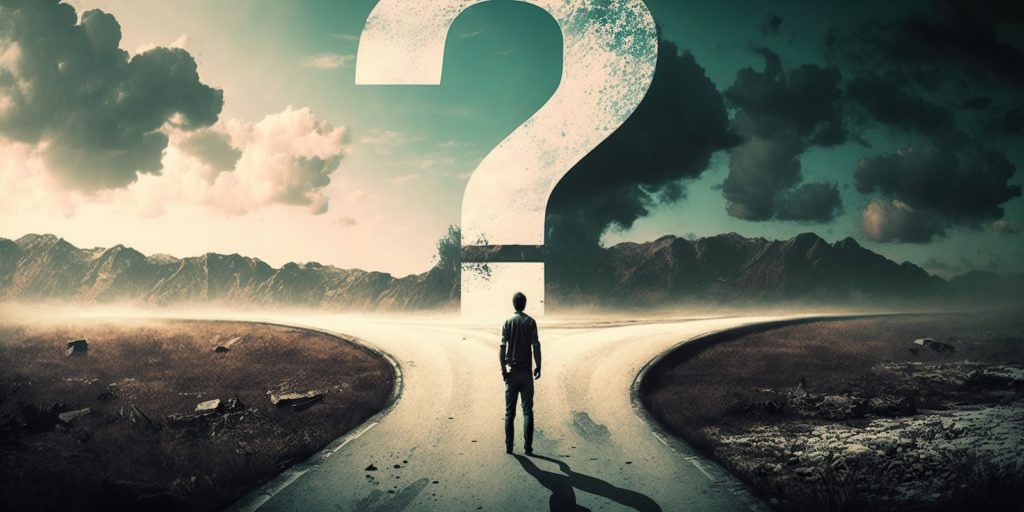
Gut gebrüllt Löwe. Dann aber bitte “dezentral radikal” die Eigenproduktion und Bedarfsdeckung am Einzelindividuum festmachen.
Gut gebrüllt Löwe. Dann aber bitte “dezentral radikal” die Eigenproduktion und Bedarfsdeckung am Einzelindividuum festmachen