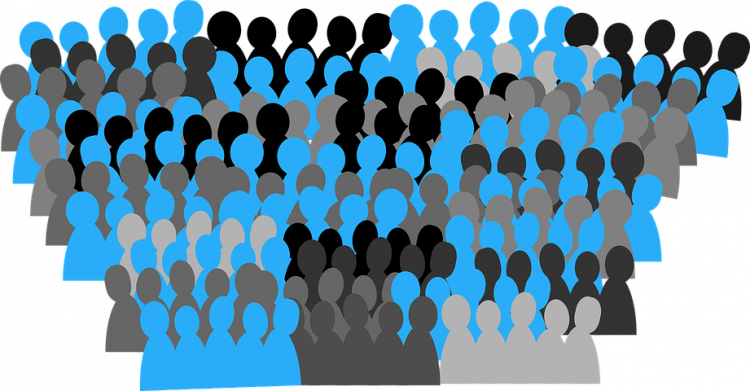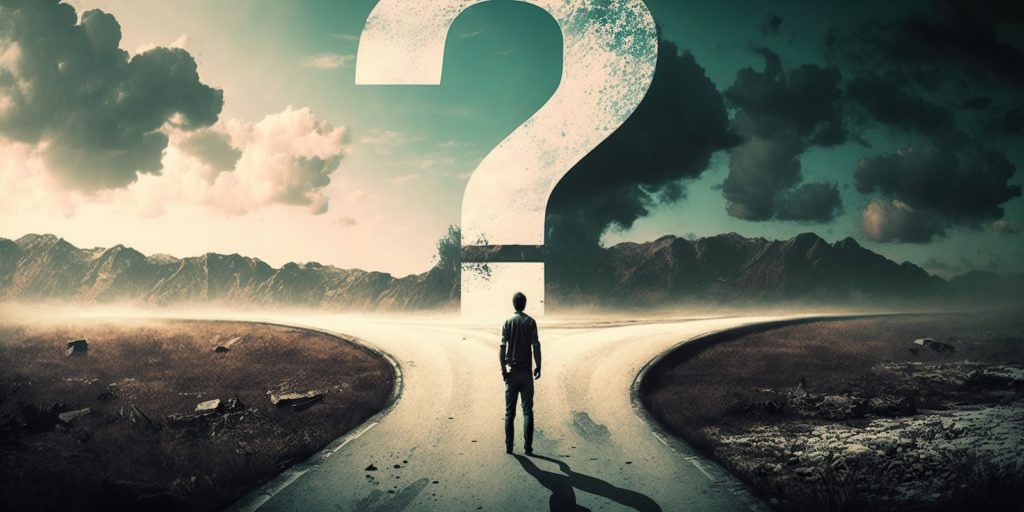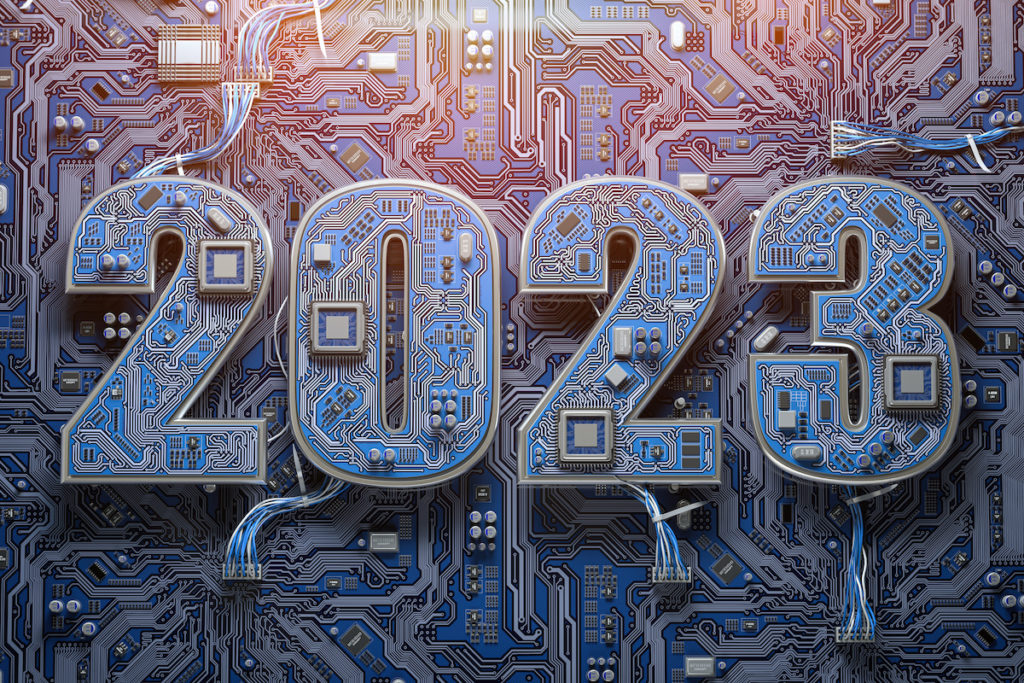Während das bisherige Energiesystem mit fossilen und nuklearen Energieressourcen auf einer zentralen Logik basiert, eröffnen die erneuerbaren Energien vielfältige Chancen zur Beteiligung (Partizipation) verschiedener gesellschaftlicher Kräfte, insbesondere für die Bürger, mittelständische Unternehmen, Kommunen und Regionen. Dieser Fakt führt zu vielen Formen dezentraler Erzeugung von elektrischer Energie bis in die Gebäude.
Dies eröffnet wiederum neue Möglichkeiten der Gestaltung von Gebäuden und Landschaften, die als energetisch aktive Systeme eigenständig Energie gewinnen, speichern und nutzen, Energieflüsse optimieren aber auch Energie austauschen können. Eine bisher vorrangig statische Betrachtung im gestalterischen Prozess gewinnt zunehmend eine dynamische Komponente. Die Gestaltung von Energielandschaften erfordert deshalb eine neue Methodik, um die Gestaltung von interagierenden Räumen (Gebäude, Siedlungsgebiete) als verbundene Prosumenten im Energiesystem zu ermöglichen.
Damit entsteht ein deutlich komplexeres System in seiner höheren Vielfalt, Verbundenheit und Organisiertheit als das bisher einfach strukturierte Energiesystem. Mit hoher Komplexität eines Systems, das nicht mehr eindeutig in den Ergebnissen berechenbar ist, sondern eher ein selbstorganisierendes, dynamisches System im metastabilen Zustand darstellt, tut sich Technik aber heute noch schwer.
Technik zielt auf berechenbare, relativ einfache Systeme ab. Komplexität als Grundlage sich entwickelnder dynamischer Systems basiert aber auf Vielfalt und damit auf Differenzierung, die bezüglich ihrer Entwicklung nicht mehr vollständig kontrollierbar ist.
Die bisherige Einfachheit entspricht der klassischen physikalischen Herangehensweise. Im physikalischen Reduktionismus gibt es keine Wirkungen, außer den physikalisch erfassbaren. Physik führt die Zerlegung in Einzelbestandteile, um dann aus einem reduktionistischem Bild der Weltformel alles Geschehen zusammensetzen zu können (determinierte Welt). Heutige Überlegungen, basierend auf den Erkenntnissen der Quantenphysik zur Verschränkung, führen zu einer Physik der Emergenz, in der aus dem Zusammenwirken von Bestandteilen neue Eigenschaften entstehen, die aus den Gesetzen der einzelnen Bauteile nicht ableitbar sind. Hieraus folgt die Selbstorganisation.
Diese sehr abstrakte wissenschaftliche Betrachtung führt aber zur praktischen Frage, ob wir in Bezug auf die Akzeptanzuntersuchungen bezüglich der notwendigen Maßnahmen für die Energiewende einen sehr wichtigen Aspekt nicht betrachten.
Die Akzeptanzfrage bei Veränderungsprozessen ist in der Regel eine Betrachtung von Verfahren zur Abwägung von Interessen betroffener Parteien in einem System, wobei Vorhaben im System oft durch Beteiligte eines übergeordneten Systems organisiert werden (z.B. Stuttgart 21 entstand aus europäischen und nationalen Aspekten und war nicht weitgehend aus den Notwendigkeiten Stuttgarts organisiert).
Im übergeordneten System werden Vorhaben beschlossen, die im eingebetteten kleineren System kaum lokale Nutzenaspekte besitzen, sondern der breite Nutzen erst im übergeordneten System sichtbar wird [Kornwachs, K. (01/2011)]. Der Nutzen ist im eingebetteten System nicht unbedingt offensichtlich. Dies gilt zum Beispiel auch für die Diskussion zum Ausbau der Übertragungsnetze.
Wenn dann Vorhaben vom übergeordneten System vorrangig mit Machtanwendung durchgesetzt werden, sind Akzeptanzprobleme vorprogrammiert.
Unter dieser einseitigen Interessenlage eines übergeordneten Systems wird das Thema Beteiligung nur unter dem Aspekt der Möglichkeit zur Teilhabe an der Genehmigungsdiskussion geführt. Man möchte nur Vorbehalte Betroffener abbauen und den Nutzen für die Allgemeinheit hervorheben.
Wenn Beteiligung aber weiter gefasst wird und Selbstgestaltung im eigenen System bedeutet, ist Akzeptanz für Notwendigkeiten einer Veränderung bei Interessenträgern im System offensichtlich leichter zu erreichen.
Leider ist heute noch nicht zu sehen, dass Mechanismen zur Akzeptanzerhöhung durch Beteiligung in Form der breiten wirtschaftlichen Mit- und Selbstgestaltung eine große Rolle spielen. Hier besteht Handlungsbedarf.
Dieser Aspekt der Beteiligung (Partizipation) wurde insbesondere hervorgehoben, als beim Forschungsministerium des Bundes der sozioökonomische Forschungsbedarf bei der Transformation des Energiesystems im Rahmen der Forschungen zur Energiewende bestimmt wurde.
In den heutigen Prozessen der Akzeptanzuntersuchung findet also vorrangig die Gegenüberstellung der Wertvorstellungen der Protagonisten und Betroffenen statt.
Ein anderer Ansatz wäre die Etablierung eines Systems, bei dem die Wertvorstellungen aller Beteiligten eigenverantwortlich und gleichberechtigt gestaltbar sind, aber ebenso Anreize vorhanden sind, so dass sich ein Verbund subsidiärer Interessen organisch eingebettet in übergeordneten Interessen entwickeln kann und somit ein selbstorganisierter Gesamtorganismus entsteht. Dies ist aber weniger berechenbar und kontrollierbar, wobei wir wieder am Anfang obiger Betrachtungen wären.
Wenn dies auf die Transformation des Energiesystems übertragen wird, ergibt sich zwangsläufig die folgende Fragestellung.
Behalten wir das heutige Bild des reduktionistischen Energiesystems mit zentraler Erzeugung und Steuerung aus den Übertragungsnetzen mit kalkulierbarer Verantwortlichkeit bei wenigen Akteuren für das Gesamtsystem und klaren Regeln zur Verteilung der Energie bei?
Oder können wir ein sehr diversifziertes, gleichzeitig dezentral und überregional verbundenes Energiesystem mit einer hohen Vielfalt von Akteuren entwickeln, die in ständiger Interaktion verbunden und mit einem klaren Satz von Regeln organisiert sind, aber gleichzeitig hohe Freiheitsgrade besitzen. Ziel eines diversifizierten Systems ist die gestalterische Beteiligung einer Vielzahl von Akteuren zur Eröffnung von breiten, wirtschaftlich gleichberechtigten Chancen bei Bürgern, Unternehmen, Kommunen und Regionen.
Der diversifizierte Ansatz in einem derartigen Energieorganismus führt aber auch zu einem anderen Bild der Kontrollierbarkeit der Entwicklung eines technischen Systems.
Der aktuelle Stand der Diskussion zur Architektur des zukünftigen Energiesystems wird damit zunehmend auch zu einer Diskussion im Rahmen der Technikphilosophie und gesellschaftlicher, nicht monetärer Nutzensaspekte. Diese Diskussion ist nicht durch eine rein volkswirtschaftliche Kosten-/Nutzen-Analyse zu führen.
Die wissenschaftliche Herausforderung für diesen abstrakten Exkurs in den Nutzen dezentraler Energiesysteme wäre also zunehmend Forschungsarbeiten in die Richtung zu entwickeln, die sich im Rahmen der Technikentwicklung auf Basis eines komplexen, sich dynamisch entwickelnden Systems mit geringerer Kontrollierbarkeit mit den philosophischen und kulturellen Konsequenzen beschäftigen sowie auch in die Partizipationsforschung eingehen.
Kornwachs, K. (01/2011): Expertise. Grundfragen der Technikakzeptanz. Ethische Probleme und Methodenfragen. Bericht an den Lehrstuhl für Technikphilosophie, Berichte an die Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik, PT-01/2011 BTU Cottbus und Büro für Kultur und Technik, Argenbühl-Eglofs 2011, ISSN 14362929