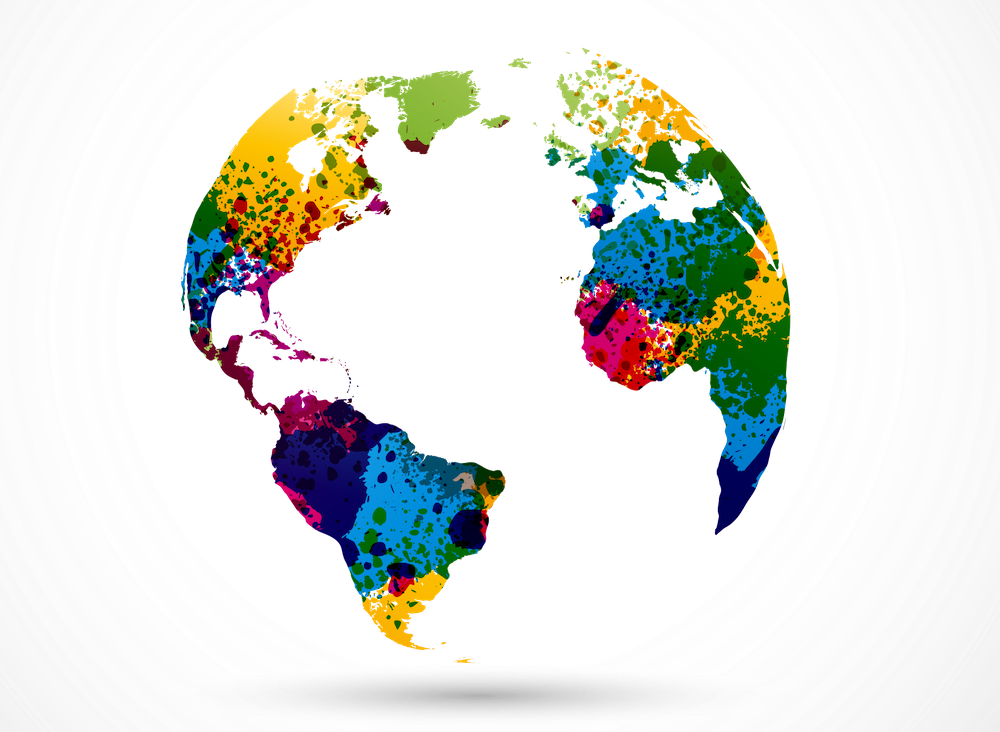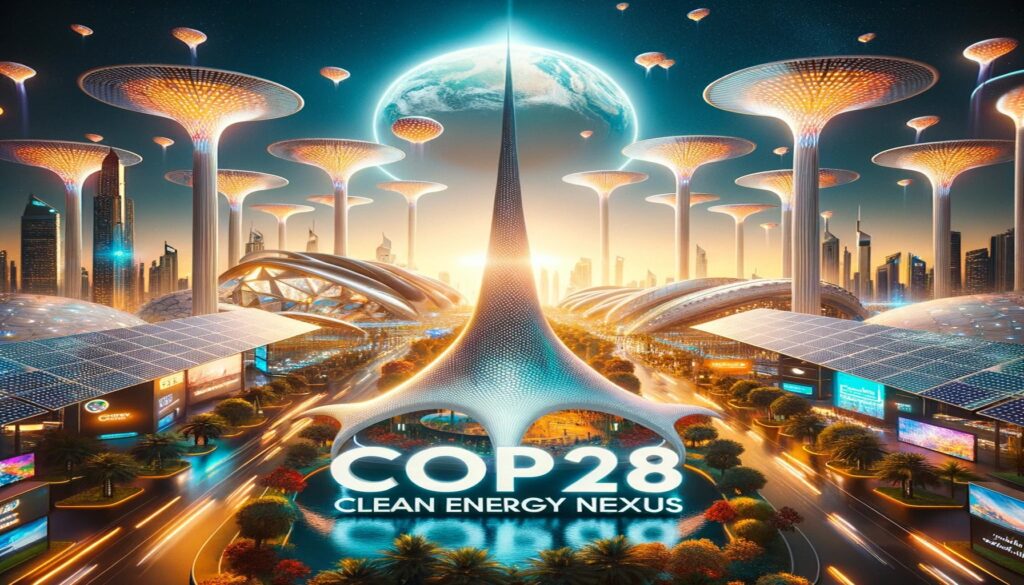Mehr Beteiligung und Gestaltungsvielfalt
ermöglichen
Denkanstoß zur politischen Willensbildung im Kampf gegen den Klimawandel
Politische Willensbildung
Die Klimaaktivistin bei FridaysForFuture Luisa Neubauer sagt: „Wenn politischer Wille da ist, kann er Berge versetzen.“
Es stellt sich nun die Frage, was die Gesellschaft aus dieser Erkenntnis lernt. Eine persönliche Schlussfolgerung formulierte ich im April des ersten Corona-Jahres in folgender Weise. „Wenn wir lernen, wie die zukünftige Gesellschaft durch die Übernahme lokaler und regionaler Gestaltungshoheit widerstandsfähiger zu gestalten ist, war die Lektion durch die Corona-Krise letztendlich hilfreich.“ Die Schlussfolgerung lautete, dass Regionalität die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft stärkt und die Voraussetzung für Globalisierung und damit für verbundene, gerecht zusammenwirkende Gesellschaften bildet.
Eigentlich müssen wir Corona danken. Wir erkannten, dass ein starker Grad an Zentralisierung Flexibilität gefährlich reduziert. Auch demokratische und marktwirtschaftliche Gesellschaften sind nicht vor zu starker Planung und Detailregulierung geschützt. Es stellt sich aber die Frage, welcher politischer Wille benötigt wird, um den Kampf gegen den Klimawandel erfolgreich zu bestehen.
Gesellschaftliche Wege im Kampf gegen den Klimawandel
Zur Beantwortung setzen wir zuerst den politischen Willen und das Ziel voraus, dem Klimawandel mit aller Kraft zu begegnen. Bei der Bestimmung des Weges lassen sich aber zwei entgegengesetzte Richtungen festgestellen. Einer dieser Wege ist von einem hohen Grad an Zentralisierung und des staatlichen Dirigismus geprägt; insbesondere bei der Gestaltung des zukünftigen Energiesystems. Der andere Weg führt zu einem dezentralen System mit hohem Autonomiegrad der lokalen und regionalen Gestaltung, bei gleichzeitig verbindenen Regeln und einem zentral organisierten Überbau.
Der Streit um den richtigen Weg ist nicht neu. Dank dem technischen Genie von Edison und Tesla wurde das elektrische Energiesystem geschaffen. Beim Ziel, die Welt mit Elektrizität zu verbessern, waren sich die Beiden einig. Der Streit um Gleichstrom und Wechselstrom entzweite die genialen Erfinder. Aber, obwohl Tesla das Wechselstromsystem erfolgreich auf den Weg bringen konnte, umfasste seine eigentliche Vision kein zentrales Energiesystem. Sein Anliegen bestand darin, jedem Menschen an jedem Ort zu ermöglichen, Energie zu gewinnen. Wissenschaft und Technik waren noch nicht für die Nutzung von Wind, Sonne und anderen, in der Umgebung vorhandener Energieformen bereit. Die Nutzung von Kohle und Öl veränderte die Welt und führte zum weltumspannenden Aufbau eines zentralen Energiesystems. Die Zentralisierung führte dabei zur Bündelung wirtschaftlicher Macht auf wenige Akteure, aber auch zu einem hohen Maß an zentraler, staatlicher Regulierung.
Lokales Handeln und globales Denken verbinden
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Frau Prof. Shoshana Zuboff macht in ihrem Buch „In the age oft the smart machine“ schon in den 1980-er Jahren deutlich, dass letztendlich ein zentralistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsentwurf im Umfeld von Digitalisierung, Automatisierung und Überwachungstechnologien eher zu demokratiegefährdender Kontrolle und Entmündigung neigt. Ein dezentraler Gegenentwurf basiert auf Selbstverantwortung sowie Autonomie und Freiheit des Handelns. Dazu gehören regionale Wirtschaftsmechanismen und Gesellschaftsfunktionen. Lokales Handeln und globales Denken sind also zu verbinden. Dies ist die logische Konsequenz zur Erhaltung von Freiheit, die die Grundlage der Demokratie ist.
Der Kampf gegen den Klimawandel kann nur mit der Umstellung auf eine nachhaltige Lebensweise gelingen. Dies umfasst die Transformation zu einem nachhaltigen Energiesystem. Bei der Entscheidung, ob dieses System zentral oder dezentral zu gestalten ist, helfen uns sowohl die Lektionen während der Corona-Pandemie als auch die Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaftlerin Zuboff.
Das oben angesprochene Willensbildung politischer Institutionen zur Stärkung von Dezentralität unter den Bedingungen der Globalisierung benötigt wahrscheinlich noch weitere Motivation. Deshalb werden wir nun die Herausforderungen für die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik sowie die Bewusstseinsbildung für Chancen der Energiewende im Spannungsfeld zwischen Masterplänen und Selbstorganisation betrachten.
Abgeben von Kontrolle und Zulassen von Komplexität
Der Weg zu einem nachhaltigen Energiesystem erfordert zuerst, das Verhältnis zwischen Kontrolle der Energieflüsse durch Staat und Energieunternehmen sowie Eigenverantwortung und Autonomie der Bürger, Unternehmen und Lokalpolitik neu zu bewerten. Zwischen nationalen, kontinentalen und globalen Energiesystemen sowie lokalen und regionalen Handeln liegt ein weites Feld.
Corona lehrte uns, dass die Reduktion von Kontrolle effektiver zum gemeinsamen Ziel führen kann. Staaten, die mit weniger Bürokratie agierten, konnten schneller eine höhere Impfquote verzeichnen. Deutschland musste sowohl mit der Pandemie, aber auch bei der Transformation des Energiesystems lernen, dass Überbürokratisierung und Regulierung bis in die Details kein Erfolgsrezept sind.
Einmal erlangte Kontrolle wird aber ungern wieder abgetreten. Dafür gibt es gute Argumente, denn der Verlust an Kontrolle verursacht das Wachstum von Komplexität. Es ist deshalb notwendig, sich mit dem schwierigen Thema Komplexität zu beschäftigen.
Von der Natur lernen heißt siegen lernen
Die menschliche Gesellschaft bildet sicherlich ein hoch komplexes System. Die Informationsflüsse sowie die Energie- und Stoffflüsse im sozialen Umfeld als auch in Wirtschaft und Handel sind Grundlage eines vielfältigen Netzwerkes zwischen den Teilen der Gesellschaft. Aber die Vielfalt der Elemente einer Gesellschaft und ihrer Organisationsformen begrenzt die Möglichkeiten der Verbindung aller Teile und des Informationsaustausches. Die Komplexität wächst, da nicht mehr alle Wirkungen der einzelnen Teile auf das Ganze zu bestimmen sind. Deshalb werden zentrale Systeme aus weniger Teilen oft als leichter beherrschbar angesehen.
Nun lernt die Gesellschaft aber gerade durch Corona, dass Zentralisierung das Ganze anfälliger gegen Störungen macht. Dezentralisierung im Verbund vieler Teile kann die Widerstandskraft der Gesellschaft erhöhen. Dies ist aber nicht zwingend, denn das Zusammenwirken vieler Teil kann auch im Chaos münden. Die menschliche Gesellschaft durfte dies in vielen Kriegen zwischen egoistisch agierenden Teilen der Welt leidvoll erfahren. Scheinbar stabile Gesellschaften zerbrachen.
Wenn es also gilt, zentrale Kontrolle abzugeben und mehr dezentrale Strukturen zu entwickeln, wie begegnen wie somit der wachsenden Komplexität.
Eigentlich macht es uns die Natur vor. Komplexität lässt sich beherrschen, wenn das Ganze in kleinere Teile zerlegt wird, die autonom und eigenverantwortlich wirken können, aber miteinander nach festgelegten Regeln interagieren. Dazu existieren Vorschläge einer zellulären Systemgestaltung, wie es die Natur mit der Entwicklung des Lebens vormacht.
Mit der fortschreitenden Transformation zu einer klimaneutralen Energieversorgung ist die Energiewirtschaft zur Beherrschung wachsender Komplexität neu zu organisieren. Zur Lösungsentwicklung und Demonstration förderte die Bundesregierung umfangreiche Programme. In diesem Rahmen formulierte eines der zugehörigen Projekte unter dem Titel C/sells drei Grundprinzipien: Partizipation, Vielfalt und Zellularität.
Partizipation, Vielfalt und Zellularität
Dezentralisierung basiert auf der Mitgestaltung breiter Akteursgruppen der Gesellschaft. Dafür steht der Begriff Partizipation. Beteiligung schafft gleichzeitig Akzeptanz für Veränderungsprozesse. Mit dezentral gewonnener Energie kann Quartiers- und Stadtentwicklung neu definiert werden. Diejenigen, die bereits heute Klimaschutz vorantreiben wollen (z.B. Bürger, Kommunen, Stadtwerke, Energiedienstleister) erhalten mehr Gestaltungshoheit bei Aufbau und Betrieb von Infrastrukturen. Neue Geschäftsmodelle führen zu lokaler und regionaler Wertschöpfung sowie zu neuen Möglichkeiten der Teilhabe in der Energiegemeinschaft.
Beteiligung und autonome Gestaltung führen aber durch die hohe Zahl der Akteure und technischer Komponenten zu einer bisher nicht gekannten Vielfalt im Energiesystem. Dabei befördert Dezentralisierung Vielfalt und wird umgekehrt durch die dafür notwendige Digitalisierung von ihr befeuert. Vielfalt ist eine Herausforderung, da die Komplexität steigt, aber auch Chance für Innovationen und Partizipation. Somit ist Vielfalt sowohl Ergebnis als auch Ziel der Entwicklungen.
Beteiligung und autonome Gestaltung zerlegen das Energiesystem quasi in Teilsysteme, in Zellen, die Mittel zur Beherrschung von Komplexität sind. Mit autonomen Energiekonzepten in Gestaltungszellen wie Gebäuden und Stadtquartieren sowie gewerblichen, industriellen und ländlichen Arealen wird die Verantwortung im lokalen und regionalen Umfeld mit der Erschließung neuer Wertschöpfungsmöglichkeiten übernommen. Die Verbindung dieser Zellen gewährleistet wiederum Austausch und Sicherheit in der Gemeinschaft. Regeln sowie gemeinsame Standards sind Mittel zur Beherrschung von Vielfalt.
Offen bleibt die Frage, mit welchen Mechanismen und Werkzeugen ein Verbund von autonomen Energiezellen ein stabiles Ganzes im Verbund bildet.
Flexibilität als Erfolgsmodell der Natur
Zur Beantwortung dieser Fragestellung kehren wir wieder zum Begriff Flexibilität zurück. Ein stabiles, aus autonomen Teilen zusammengesetztes Ganzes benötigt Flexibilität, um auf unvorhergesehene Ereignisse reagieren zu können.
Starre, unflexible Regeln des Zusammenwirkens können aufgrund fehlender Flexibilität zum Zusammenbruch führen. Auch marktwirtschaftlich organisierte Systeme sind dabei vor dem Mangel an Flexibilität nicht geschützt. Die Konsequenzen vollständig optimierter, globaler Lieferketten mit minimaler Lagerhaltung wurden mit der Corona-Pandemie offensichtlich.
Flexibile Systeme besitzen in unvorhergesehenen Situationen alternative Handlungsmöglichkeiten. Somit ist Flexibilität der Schlüssel zur Beherrschung komplexer Systeme. Dies gilt analog für die Flexibilisierung eines zukünftigen Energiesystems, das auf Erneuerbaren Energiequellen und dezentraler Erzeugung beruht.
Analog zu flexiblen Lieferketten mit ausreichenden Handlungsoptionen durch Lagerkapazitäten benötigen zukünftige Energiesysteme vielfältige Kapazitäten von Energiespeichern, um flexibel miteinander interagieren zu können. Die im Stromsystem nutzbare Flexibilität ist dabei nicht ausreichend. Notwendig wird deshalb zunehmend die Kopplung verschiedener Energiesektoren. Dies umfasst die integrierte Betrachtung der Energieflüsse und Bedarfe an elektrischer Energie, Wärme und erneuerbarem Gas sowie von Energieträgern für Mobilität und Industrieprozesse.
Politische Willensbildung von unten nach oben und die Rolle der Städte
Wir lernten in den letzten Jahren, dass der Umbau zu einem nachhaltigen Energiesystem im Kampf gegen den Klimawandel ein äußerst komplexer Gestaltungsprozess ist. Dagegen ist politische Willensbildung oft von für Politiker und Wähler einfach fassbaren Konzepten geprägt. Wie kann also die Willensbildung auf dem Weg zur Dezentralisierung wichtiger gesellschaftlicher Infrastrukturen erfolgen, um Widerstandsfähigkeit und Flexibilität zu stärken?
Letztendlich ist staatliche Politik nur die Spitze des Eisberges. Getragen wird Politik und Bereitschaft für Veränderungsprozesse im unmittelbaren Lebensumfeld der Menschen; in Stadt und Land. Insbesondere Städte spielen eine zentrale Rolle für die Energiewende und den Klimaschutz. Autonome Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien, neuer Werkstofftechnologien sowie der Digitalisierung führen zu neuen Formen des Bauens.
Gleichzeitig bringen Klimawandel, zunehmende Vernetzung und eine globalisierte Welt neue Gefahren für die sichere Funktion der Stadt mit sich. Dies zeigt die zunehmende Anzahl der Cyber-Angriffe aus dem Internet wie auch die aktuelle Corona-Krise. Die Stadt muss sich mit autonomen Funktionen auf diese Gefahren einstellen. In diesem Umfeld sind neue Lösungen zu schaffen, zu demonstrieren und zu vervielfältigen.
Die Stadt der Zukunft kann nicht autark funktionieren. Aber erneuerbare Energien und Dezentralisierung ermöglichen die Entwicklung autonomer, widerstandsfähiger Infrastrukturen mit regionaler und überregionaler Vernetzung.
Wir benötigen somit einen Prozess von unten nach oben, der den Willen und die Möglichkeiten der Teilhabe am Umbau des Energiesystems von der lokalen Politik bis zur staatlichen Politik trägt.
Andreas Kießling, energy design, Leimen / Heidelberg — 26. Juni 2021
Andreas Kießling, energy design