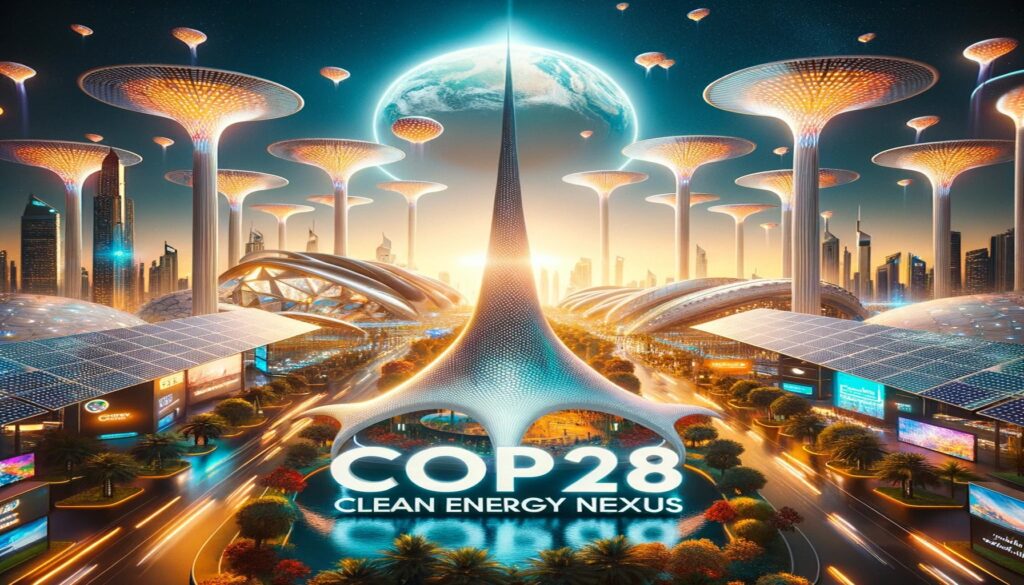Klimaneutralität unter der Lupe
Klimamodelle, CO₂ und die Rolle der Sonne – Ein kritischer Blick auf die Grundlagen der Klimapolitik von Cohler et al. (2025)
Wie solide sind die wissenschaftlichen Grundlagen der ambitionierten Klimaziele Deutschlands? Ein neuer Fachartikel von Cohler et al. nimmt das Thema Klimaneutralität unter die Lupe und wirft einen kritischen Blick auf die Rolle des CO₂ in den IPCC-Klimamodellen. Er plädiert für eine stärkere Berücksichtigung natürlicher Variabilitäten wie Sonnenaktivität und ozeanische Zyklen. Dieser Beitrag analysiert die wichtigsten Aussagen, Argumente und Widersprüche – und hinterfragt die politische Ableitung daraus.
“Der Zweifel ist kein angenehmer Zustand, aber Gewissheit ist ein absurder.“
Voltaire
Wie sicher ist der Konsens der Wissenschaft zum Thema CO2 wirklich?
Die globale Erwärmung, ihre Ursachen und die politischen Konsequenzen daraus gehören zu den zentralen Themen unserer Zeit. Der Begriff „Klimaneutralität“ ist in aller Munde – in Medien, Politik und Wirtschaft wird er nahezu inflationär gebraucht. In Deutschland wurde das Ziel der „Netto-Null-Klimaneutralität“ sogar in Gesetzesform gegossen: Ab dem Jahr 2045 sollen sämtliche menschengemachten Treibhausgasemissionen vollständig kompensiert oder vermieden sein.
Doch wie solide ist die wissenschaftliche Grundlage dieser Zielsetzung tatsächlich? Und ist die Interpretation, wie sie etwa vom Weltklimarat (IPCC) vertreten wird, tatsächlich der einzige gültige Maßstab? Diese Fragen stellt ein wissenschaftlicher Beitrag von Jonathan Cohler, David Legates, Willie Soon und anderen, der Anfang 2025 unter dem Titel „A Critical Reassessment of the Anthropogenic CO₂–Global Warming Hypothesis“ veröffentlicht wurde. Der Artikel wirft einen differenzierten, aber auch provokanten Blick auf die gängige Klimaforschung – und fordert ein gründliches Nachdenken über das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und gesellschaftlichem Handeln.
Zentrale These: Anthropogenes CO₂ als überschätzter Klimatreiber
Die Kernaussage des Artikels lautet: Der Einfluss von CO₂-Emissionen aus menschlicher Tätigkeit auf das globale Klima wird in den Modellen und Einschätzungen des IPCC systematisch überschätzt. Zwar erkennen die Autoren an, dass die Erde sich im 20. und 21. Jahrhundert erwärmt hat. Die Ursache dafür sehen sie jedoch nicht primär in den durch Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft verursachten CO₂-Emissionen, sondern in einem Zusammenspiel natürlicher Klimatreiber – insbesondere der Sonnenaktivität und ozeanischer Zyklen.
Dabei berufen sich die Autoren auf mehrere empirische und statistische Analysen, die nahelegen, dass die Temperaturentwicklung in vielen Regionen der Welt deutlich stärker mit der Intensität der Sonneneinstrahlung („Total Solar Irradiance“, TSI) korreliert als mit der Konzentration von CO₂ in der Atmosphäre. In mehreren Datensätzen finden sie Korrelationen (R²-Werte) zwischen TSI und Temperatur von 0.7 bis 0.9 – Werte, die signifikant höher seien als bei der CO₂-basierten Modellierung.
Kritik an Klimamodellen und Datenanpassungen
Besonders scharf fällt die Kritik an den sogenannten CMIP-Modellen des IPCC (Coupled Model Intercomparison Project — Projekt zum Vergleich und Validierung globaler Klimamodelle) aus, die zur Prognose künftiger Klimatrends verwendet werden. Die Autoren werfen diesen Modellen eine strukturelle Voreingenommenheit vor: Sie seien von vornherein auf CO₂ als Hauptantrieb fokussiert, während natürliche Variabilität weitgehend ausgeblendet oder unterbewertet werde.
Hinzu kommt eine tiefgreifende Skepsis gegenüber der Praxis der Datenhomogenisierung – also der nachträglichen Korrektur historischer Temperaturmessungen zur Verbesserung ihrer Vergleichbarkeit. Diese Verfahren, so die Autoren, führten dazu, dass historische Wärmeperioden wie die 1930er Jahre oder das Mittelalter systematisch abgeschwächt und die jüngste Erwärmung dadurch überzeichnet werde. Es entstehe ein „glatter“, scheinbar stetiger Temperaturanstieg, der in Wirklichkeit durch viele natürliche Schwankungen geprägt sei.
CO₂: Kurzlebiges Spurengas oder langfristiger Klimafaktor?
Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage, wie lange CO₂ tatsächlich klimawirksam in der Atmosphäre verbleibt. Während der IPCC von einer klimarelevanten „Verweildauer“ von Jahrhunderten ausgeht – also einer sehr langen Adjustment Time–, argumentieren die Autoren, dass die tatsächliche Residence Time von CO₂ in der Atmosphäre nur wenige Jahre betrage. Der Unterschied liegt darin, dass einzelne CO₂-Moleküle zwar schnell zwischen Atmosphäre, Ozeanen und Biosphäre zirkulieren, der „Effekt“ eines Emissionsimpulses jedoch sehr lange nachwirken kann.
Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass der menschliche Anteil am gesamten CO₂-Fluss im Erdsystem bei unter 5 % liege. Dies führe zu der Schlussfolgerung, dass der Mensch gar nicht in der Lage sei, die beobachteten Temperaturschwankungen allein durch CO₂ zu erklären – insbesondere, da die natürlichen Senken wie Wälder, Böden und Ozeane den Großteil der Emissionen ohnehin wieder aufnehmen würden.
Kausalität oder Korrelation? Was treibt was?
Ein weiterer spannender Aspekt des Artikels ist die Frage nach der Kausalität: Führt mehr CO₂ zu höheren Temperaturen – oder ist es umgekehrt? Die Autoren zitieren mehrere Studien, unter anderem auch aus der Paläoklimatologie (z. B. Vostok-Eiskerne), in denen Temperaturveränderungen zeitlich vor den CO₂-Veränderungen auftreten. Auch in der Gegenwart lassen sich laut Artikel statistisch signifikante Hinweise darauf finden, dass Temperaturschwankungen mit zeitlichem Vorlauf zu CO₂-Anstiegen führen – etwa durch Ausgasung aus wärmer werdenden Ozeanen.
Diese Beobachtung stellt die lineare Klimakette des IPCC („CO₂ hoch → Temperatur hoch“) in Frage. Zwar erkennen auch die IPCC-Berichte Rückkopplungseffekte an, doch die Autoren fordern eine neue Gewichtung der Kausalverhältnisse, insbesondere im Modellierungsansatz.
Was bedeutet das für die Politik?
Cohler et al. ziehen keine direkten politischen Schlussfolgerungen – doch ihre Argumentation stellt die Legitimität besonders ambitionierter Klimaziele zumindest infrage. Wenn die Modelle, auf denen diese Ziele beruhen, wesentliche Klimatreiber wie die Sonne oder interne ozeanische Zyklen falsch bewerten oder vernachlässigen, könnte dies weitreichende Folgen für die Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit politischer Maßnahmen haben.
Deutschland etwa verfolgt – wie bereits diskutiert – einen Sonderweg, indem es sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2045 netto keine Treibhausgase mehr auszustoßen, ohne dabei natürliche Senken anzurechnen. Ein solcher Kurs erfordert enorme Transformationen, massive Investitionen und gesellschaftliche Zumutungen. Wenn sich herausstellt, dass die wissenschaftlichen Grundlagen dafür zu einseitig oder unvollständig sind, wäre eine Korrektur – oder zumindest eine offene Debatte – dringend geboten.
Fazit: Keine Gewissheiten, aber viele offene Fragen
Der Artikel von Cohler ist kein Frontalangriff auf die Klimawissenschaft, sondern ein methodisch fundierter, empirisch gestützter und sachlich formulierter Gegenentwurf zur vorherrschenden Sichtweise. Seine Stärke liegt in der Aufdeckung von Schwächen der Klimamodelle, der differenzierten Datenbetrachtung und der kritischen Reflexion von Kausalzusammenhängen.
Natürlich bleibt Kritik angebracht: Die Auswahl der Datensätze ist selektiv, alternative Hypothesen ersetzen noch kein vollständiges Erklärungsmodell, und einige Argumente wiederholen bekannte Positionen der sogenannten Klimaskeptiker. Dennoch verdient der Artikel ernsthafte Beachtung – nicht zuletzt deshalb, weil Wissenschaft keine Dogmen kennt, sondern fortlaufend hinterfragt werden muss.
In einer Zeit, in der politische Weichenstellungen auf Jahrzehnte hinaus getroffen werden, wäre eine breite, ehrliche und interdisziplinäre Diskussion über die Grundlagen des Klimahandelns nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.
Quellen
-
Cohler, J., Legates, D., Soon, W., et al. (2025). A Critical Reassessment of the Anthropogenic CO₂–Global Warming Hypothesis. Science of Climate Change.
-
IPCC (2021). Sixth Assessment Report. Intergovernmental Panel on Climate Change.
-
Harde, H. (2017). What Humans Contribute to Atmospheric CO₂: Comparison of Carbon Cycle Models with Observations. Int. J. Atmos. Sci.
-
NOAA, NASA GISS, Berkeley Earth – Temperaturdatenbanken und Homogenisierungsverfahren.
-
Soon, W., Connolly, R., & Connolly, M. (2015). Re-evaluating the Role of Solar Variability on Northern Hemisphere Temperature Trends. Earth-Science Reviews.
Klimaneutralität unter der Lupe: Leimen / Heidelberg — 04. April 2025
Andreas Kießling, energy design